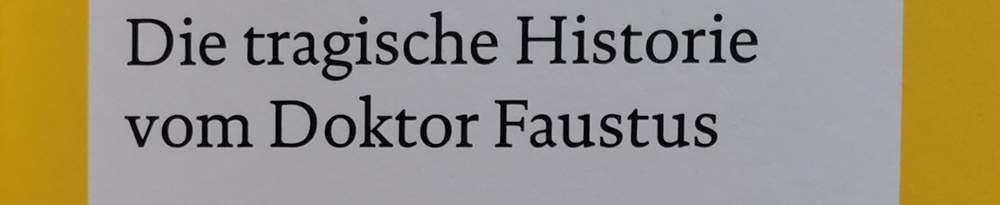Faust ist mehr oder weniger eine Erscheinung des deutschen Sprachraums geblieben – im Gegensatz zum Beispiel zum ungefähr gleich alten Mythos des Don Juan. Nur zwei nicht-deutsche Bearbeitungen des Faust-Stoffs sind mir bekannt. Die eine ist das hier vorzustellende Drama von Christopher Marlowe. Bei der anderen handelt es sich um die Oper von Gounod, die ihre Existenz aber der grassierenden Goethe-Manie der paneuropäischen Romantik verdankt, also letzten Endes irgendwie auch „deutsch“ ist. Marlowe hingegen hat lange vor Goethe gelebt; bei ihm wäre allenfalls ein Einfluss in umgekehrter Richtung denkbar. Allerdings verschwand Marlowe kurze Zeit nach seinem Tod in einer vorübergehenden literarischen Versenkung und mit ihm seine Stücke. Das eine oder andere, darunter auch der Doktor Faustus wurde zwar auch ohne Autorenzuschreibung weiter tradiert – galt aber deswegen nicht unbedingt als ‚Hochliteratur‘. Der eine oder andere Kritiker sah deren Wert trotzdem. So kam Lessing, im 17. Literaturbrief beiläufig auf diesen anonymen Faust zu sprechen. Auch ohne Autor war es für ihn klar, dass dieses Stück eine Menge Szenen [hat], die nur ein Shakespearsches Genie zu denken vermögend gewesen. Obwohl es Versuche gibt, auch Goethe eine Kenntnis dieses Texts zuzuschreiben, halte ich das für unwahrscheinlich. Weder der Stürmer und Dränger, noch der Weimarer Klassiker erwähnen es je – weshalb aber hätte Goethe so persistent dessen Lektüre verschweigen sollen? Zu seiner Kenntnis kam das Stück (kam Marlowe?) wohl tatsächlich 1818. Damals nämlich wurde es erstmals ins Deutsche übersetzt, von Wilhelm Müller. Goethe erhielt ein Exemplar der Übersetzung vom Herausgeber (Achim von Arnim), äußerte sich aber nicht weiter darüber. Immerhin gab er es an Charlotte von Schiller weiter, scheint es also nicht völlig verdammt zu haben.
Goethe braucht Marlowes Stück – rein inhaltlich gesehen – auch nicht gekannt zu haben. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, die den Kern des Plots, den eigentlichen Stoff, nicht betreffen, hielt sich der Engländer nämlich, was das Skelett der tragischen Historie betrifft, eng an das englische Buch vom Doktor Faust, das wiederum eine Übersetzung der 1587 bei Spieß erschienenen Historia von D. Johann Fausten darstellt. Um also das Skelett von Marlowes Drama kennen zu lernen, genügt es, die deutsche oder englische Historia gelesen zu haben. Natürlich passt Marlowe den Ablauf ein wenig an die Gegebenheiten der Bühne, der elisabethanischen Bühne, an. Er kürzt – manchmal derart stark, dass es schwierig wird, dem Handlungsfaden zu folgen. Er erweitert aber auch, vor allem um Hanswurst- und Rüpelszenen. Diese sind von einem etwas derben Humor, erfüllen aber ihren Zweck des ‚comic relief‘ perfekt. Die chronologische Abfolge der Ereignisse ist aber so ziemlich derselbe wie in der Historia.
Faust also ist, wie im Volksbuch, auch bei Marlowe der Intellektuelle ( auch ein Theologe), der sich in übermächtigem Wissensdrang der Magie ergibt und sich dem Teufel verschreibt – in erster Linie, um noch mehr wissen zu können, in zweiter, um alle Frauen haben zu können, nach denen es ihn gelüstet. Um politische Macht geht es weder im deutschen Original noch im englischen Drama. Faust ist nur, wenn es ums Wissen geht, der Archetyp des Renaissance-Menschen. Immer mit einem lateinischen Zitat auf den Lippen (meist Scholastikern entnommen und im damaligen Universitätsjargon gang und gäbe), lernt er von zwei Freunden, den Teufel zu beschwören. (Ob Marlowe in den beiden Freunden auf Paracelsus und Agrippa von Nettesheim als Zeitgenossen Fausts zielte, ist umstritten. So oder so werden im Laufe des Dramas immer wieder verschiedene – mittelalterliche oder antike – Wissenschaftler erwähnt, denen der Volksmund später magische Fähigkeiten zugeschrieben hatte: Galen, Roger Bacon oder Albertus Magnus. Ob Marlowe, bzw. seine Zeit, selber noch an Magie glaubten? Immerhin geht die Sage, dass die Bühnenmaschinerie bei der Erstaufführung derart gut funktionierte, eine derart perfekte Illusion hervorrief, dass viele im Publikum dahinter echte Zauberei vermuteten.)
Bei der Charakterisierung des Teufels nun – und da es sowieso der Teufelsgestalten wegen ist, dass ich all die vielen Faust-Versionen durchackere, freut mich das besonders – weicht Marlowe signifikant vom alten Faust-Buch ab. Mephistopheles, den Marlowes Faust beschwört und den er zu seinem Leibdiener machen will, muss zuerst bei seinem Vorgesetzten, dem Höllenfürsten Luzifer, um Erlaubnis fragen. Natürlich erhält er sie. Wie im alten Faust-Buch will der ehemalige Wissenschaftler, nunmehrige Magier Auskunft über Herkunft der Teufel und Aussehen der Hölle. Das ist der Moment, in dem Mephistopheles ein eigenständiges, Marlowe’sches Profil gewinnt. Er möchte nämlich lieber nicht Auskunft geben, weil ihn nur schon die Erinnerung an das Glück, das die Teufel (damals noch Engel) im Himmel kannten, schmerzt. Die Erinnerung an den Sturz aus dem Himmel schmerzt ihn ebenfalls, und last but not least natürlich die Erinnerung an die Hölle, die nach seiner Aussage überall ist – also auch im aktuellen Moment bei Faust. Einen Teufel, der Gefühle zeigt, finden wir im originalen Faust-Buch nicht. Hier steht Marlowe alleine. (Dass sich sein Faust davon keineswegs abhalten lässt, macht umgekehrt auch diesen Charakter dämonischer als es der Pappkamerad der Historia sein kann, der kaum Gegenwind verspürte.)
Das Stück ist nicht lang und rasch gelesen. Aber durchaus empfehlenswert.
Christopher Marlowe: Die tragische Historie vom Doktor Faustus. Deutsch Fassung, Nachwort und Anmerkungen von Adolf Seebaß. Dieser Ausgabe liegt der erste englische Druck von 1604 zugrunde. [Allerdings sind einige Szenen nach dem zweiten Druck von 1616 eingefügt oder umgestellt worden. Wie Shakespeare hat wohl auch Marlowe den Druck seiner Dramen nicht selber in die Wege geleitet oder gar Korrektur gelesen.] Ditzingen: Reclam, 2008 / 2017 [Erste Auflage: 1964]. = RUB 1128