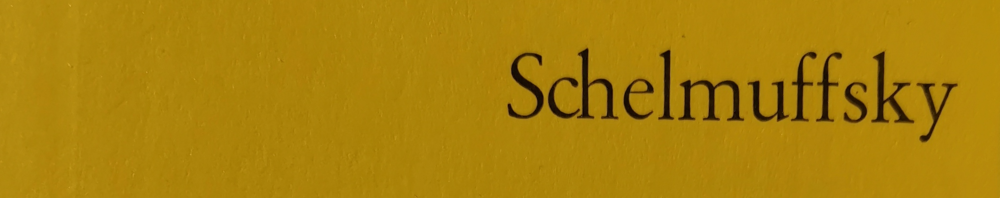Habent sua fata libelli. Dieses Buch war lange Zeit praktisch verschollen. 1696 zum ersten Mal erschienen, verschwand es sehr rasch – nicht nur aus den Buchhandlungen, sondern de facto aus dem Gedächtnis des Publikums. Es war wohl ursprünglich sowieso nicht ein Bestseller gewesen, allenfalls löste es damals in Leipzig einen gewissen Skandal aus, denn es handelte sich bei der Person des Protagonisten, Schelmuffsky, ursprünglich um eine Personalsatire auf den Sohn einer bekannten Leipziger Wirtin namens Anna Rosine Müller. Diese beherbergte auch Studenten, so den (für einen Studenten allerdings schon ziemlich alten) Christian Reuter. Reuter, der es mit der Zahlung der Miete nicht sehr genau nahm, geriet schon bald in Streit mit ihr. Da er kein anderes Mittel hatte, sich an ihr zu rächen, tat er es, indem er ein Stück schrieb, mit dem er die gesamte Familie Müller lächerlich machte. Nicht genug: Er schrieb vorliegenden Roman und doppelte so nach. Stück wie Roman wurden praktisch sofort verboten; der Roman kam sogar in Rom auf den Index (und dies, obwohl die im katholischen Sinn eigentlich anstößige Stelle, wo Schelmuffsky eine seltsame Audienz beim Papst durchmacht, bereits vorher der Zensur anheim fiel).
Der Roman verschwand also in den Tiefen der Archive – wir wissen heute von genau vier Kopien der Erstauflage, die noch existieren. Es waren dann einmal mehr die Romantiker mit ihrer Vorliebe für „altdeutsche“ Literatur, die den Schelmuffsky ins Bewusstsein der Lesenden zurück holten. Die Brüder Grimm buddelten ein Exemplar des Romans aus und veröffentlichten ihn erneut. So fiel er Achim von Arnim und vor allem Clemens Brentano in die Hände. Letzterer verwendete ihn als Kronzeugen in seinem Kampf gegen das Philistertum. Bis heute wird der Roman denn auch so gelesen – als Satire nicht nur auf die Person des Sohnes der Wirtin des Autors, sondern als „Ständesatire“ aufs Philistertum. Allerdings waren die Romantiker doch nicht ganz die ersten, die das Buch kannten und schätzten; wir wissen, dass Gottsched um das Buch wusste, und wir wissen, dass sich ein Exemplar der Erstauflage in der Bibliothek von Lichtenberg befand; dort wiederum wird es wohl auch Gottfried August Bürger gesehen und für seine Version des Münchhausen konsultiert haben. Denn Schelmuffsky, der große Aufschneider, ist ja nicht eine genuine Erfindung Reuters. Die Barockliteratur wimmelt von solchen komischen Typen; Ahnherr ist wohl Plautus‘ Miles gloriosus. (Und ja: Der immer wieder archaisierende, barockisierende Grass hat den Schelmuffsky ganz offensichtlich weidlich ausgeschlachtet.)
Dabei ist das Leben Schelmuffskys verräterisch eintönig. Es geht in diesem Roman vorwiegend ums Fressen und Saufen im Übermaß – und dementsprechend auch immer wieder ums Kotzen. Ein bisschen Liebeleien noch, und schon haben wir den beschränkten Horizont Schelmuffskys (der auch der beschränkte Horizont der übrigen Figuren des Romans ist) umschrieben. Daran ändert nichts, dass der Ich-Erzähler vorgibt, in der Welt herum gereist zu sein. Ob Hamburg, Stockholm oder Indien: Immer gibt er vor, sozusagen die gute Welt angeführt zu haben – immer ist er aber genau genommen bloß Vorbild im repetitiven Fressen, Saufen, Kotzen. Ob er in Indien als eine Art Finanzminister amtet oder in Rom dem Papst die stinkenden Füße küsst – er ist der Größte und der Beste. Zwei Mal kehrt er von seinen Weltreisen heim; zwei Mal erzählt er, wie er (in letzter Minute sozusagen!) von Räubern all seines Reichtums beraubt wurde, den er heimbringen wollte. Zwar erzählte er dort trotzdem seine Räuberpistolen und Abenteuer, die er bestanden haben wollte, aber da war ein kleiner Vetter, der ihn auslachte und fragte, wie er in vierzehn Tagen Abwesenheit alle diese Dinge erlebt haben wolle, zumal er ja das ganze Dorf wisse, dass er nur in einer Kneipe eine halbe Meile weiter das Erbe des Vaters in kürzester Zeit vertrunken habe.
Personalsatire? Ständesatire? Jedenfalls stellt der Schelmuffsky auch heute noch eine ganz amüsante Version des literarischen Schelms dar.
Christian Reuter: Schelmuffskys warhafftige curiöse und sehr gefährliche Reisebeschreibung zu Wasser und zu Lande. Herausgegeben von Ilse-Marie Barth. Stuttgart: Reclam, 1979. (= RUB 4343)