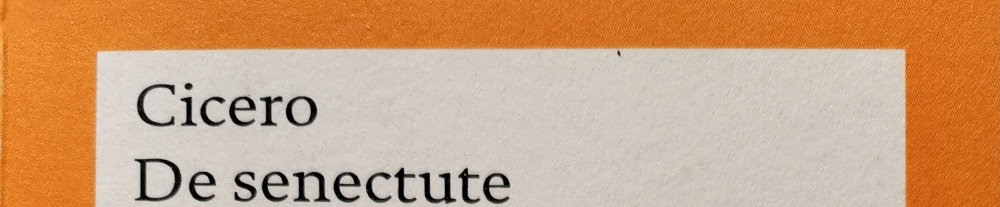Cato maior de senectute entstand 45/44 v.u.Z. Der Text gehört in die Reihe jener Schriften, mit denen Cicero einen Überblick und eine Zusammenfassung seiner philosophischen Schriftstellerei zu geben gedachte. Der Hintergrund dieses Vorhabens war, dass Cicero – der politisch zusehends in eine Gegnerschaft zum die Alleinherrschaft anstrebenden Caesar geraten war – nach dessen Ermordung nicht nur für das Römische Reich sondern auch für sich selber Morgenluft witterte. In den Jahren von Caesars Herrschaft hatte er sich schön still gehalten und nur philosophische Schriften verfasst (die natürlich auch, meinte er jetzt, immer schon politisch gedacht gewesen waren). Als ‚homo novus‘ verfügte er über keine eigene Hausmacht. Als sich herauskristallisierte, dass wohl abermals ein Triumvirat über das Reich herrschen würde, verband sich Cicero tentativ mit Octavian, ohne aber offenbar mit ganzem Herzen dabei zu sein – umso mehr, als er rasch spürte, dass in dem jungen Mann (damals rund 20 Jahre alt) dieselben autokratischen Tendenzen sprossen, wie er sie an Caesar gehasst hatte. Es kam, wie es kommen musste: Die neuen Triumvirn Mark Anton (der zunächst der starke Mann zu sein schien), Octavius und Lepidus setzten den alten Troublemaker Cicero zuoberst auf ihre gemeinsame Proskriptionsliste. Er wurde auf der Flucht von Soldaten Mark Antons getötet, Kopf und Hände der Leiche nach Rom geschickt.
So kommt es, von Cicero wohl nicht ganz so vorgesehen, dass die Abrundung, die er seiner Philosophie nach Caesars Ermordung gegeben hatte, eine endgültige war.
Cato maior de senectute ist dabei ein auch literarisch nicht übel gelungenes Stück. In der klassischen philosophischen Form eines Gesprächs treffen sich Gaius Laelius Sapiens und Publius Cornelius Scipio Aemilianus Africanus (genannt Scipius der Jüngere) auf dem Landgut des alten Marcus Porcius Cato Censorius (genannt Cato der Ältere). Die beiden Jüngeren fragen Cato (der zum Zeitpunkt des fiktiven Gesprächs 83 Jahre alt war), wie es komme, dass er die Mühen des Alters klaglos ertragen könne, während andere klagten und stöhnten?
Cato war zum Zeitpunkt, als Cicero seinen Dialog schrieb, bereits seit rund 100 Jahren tot. Das Bild der eigentlich erzkonservativen, xenophoben und antihellenischen Kriegsgurgel hatte sich im Lauf dieser Jahre verschoben und wenn man an Cato dachte, dann als einen Patrioten, der mit seinem einfachen Leben und geradem Wesen Vorbild war (sein sollte) für so manchen Jungen. Wenn Cicero in seinen Gedanken über die Natur der Götter eindeutige dem akademischen Skeptizismus angehörte, war er in Bezug auf Fragen der Politik und der Lebensführung ein konservativer Stoiker – und Cato war diesbezüglich nicht nur sein Idol. Dass Cato es war, der eine Delegation bekannter athenischer Philosophen aus der Stadt Rom verweisen ließ, scheint Cicero nicht gestört zu haben – sein Gewissen war da sehr elastisch.
Der Inhalt des Gesprächs wird einem heute sehr bekannt vorkommen. Tatsächlich hat Cicero mit seinem Text die philosophische Diskussion über das Alter auf Jahrhunderte geprägt. Noch Montaigne wird sich implizit oder explizit mit ihm auseinandersetzen. Ciceros positiver Blick auf das Alter zeigt sich darin, dass im Lauf des Gesprächs Cato alle Gründe widerlegt, die gemäß allgemeiner Auffassung gegen das Alter sprechen:
- Es halte von Taten ab: Hier macht Cato einen Unterschied zwischen physischen Taten und geistiger Tätigkeit. Sein berühmtes Beispiel sind die Matrosen, die in den Segeln herum klettern, und die er dem Steuermann entgegen setzt, der ruhig und scheinbar untätig da steht – und doch der wichtigste Mann auf dem Schiff ist.
- Mit dem ersten Vorwurf zusammen hängend: Das Alter mache den Körper schwach. Cato entgegnet darauf, dass auch junge Menschen oft einen schwachen Körper hätten, zumal wenn sie ihn durch Exzesse irgendwelcher Art strapazierten. Wichtiger als ein starker Körper ist für Cato auch ein starker Geist – und den könne man auch im hohen Alter noch trainieren. (Noch heute ein Mantra der Gerontologie!) Hier taucht dann bei Cicero zum ersten Mal das Thema ‚Sterben‘ auf, weil ein so trainierter Geist noch im Tod den Körper beherrschen und ohne Angst loslassen wird.
- Das Alter beraube einen aller Genüsse. In seiner Antwort zeigt sich Cato definitiv als Stoiker. Zunächst einmal setzt er für ‚Genuss‘ das Wort ‚Lust‘. Dann – mit einem Seitenhieb auf Epikur, dessen Philosophie Cato (und Cicero) in der klassischen stoischen Bösartigkeit als ein Anstreben höchster körperlicher Genüsse schildert – propagiert Cato die Freuden der geistigen Betätigung, die Pflege von Freundschaft, und auch die Beschäftigung mit der Landwirtschaft, ein Lieblingsthema Ciceros (der – im Gegensatz zu Cato übrigens – kaum selber den Pflug geführt haben wird), als Formen von Genuss. Dass hier der Alte die noch erreichbaren und ruhigen Genüsse über die nicht mehr erreichbaren und anstrengenden stellt, ist nicht von der Hand zu weisen. Vielleicht – aber so weit gehen Ciceros Gedanken hier nicht – ist es ja von der Natur nicht schlecht eingerichtet, dass der alte Mensch gar nicht mehr will, was sein Körper nur noch mit Mühe oder gar nicht mehr kann. Bei Cicero werden aber die ‚ruhigen Genüsse‘ apodiktisch an erste Stelle gesetzt – auch für die jungen Menschen sind sie empfehlenswerter.
- Last but not least: der baldige Tod. Hier argumentiert Cato dahingehend, dass der junge Mensch so wenig weiß wie der alte, wann sein Tod eintreten wird. Auch hat der Greis das Alter, das der junge Mensch zu erreichen hoffte, ja nun erreicht – was will er mehr? Und schließlich ist der Tod nicht zu fürchten, da er nach den Aussagen der einen die Seele vollständig auslöscht oder aber zu einem ewigen Leben führt. Wobei Cicero seinen Cato ganz eindeutig an letzteres glauben lässt, denn er spricht von seiner Hoffnung, den vor ihm gestorbenen Sohn im Totenreich wieder zu finden – sowie viele Persönlichkeiten, die lange vor ihm gelebt haben und die er nun persönlich kennen lernen kann. Trotz der Vorfreude auf dieses Leben hält Cato fest, dass jeder Selbstmord verwerflich ist, da der Mensch an der einmal hingestellten Stelle auszuharren habe bis zum Schluss. (Ja, das Selbstmord-Verbot wie das „ewige Leben nach dem Tod“ sind keine Erfindung des Christentums; auch hier hat die Stoa viel vorweg genommen – die entsprechenden Argumente inklusive.)
Wir haben in diesem Gespräch eine fürs antike Rom typische Philosophie vor uns – ausgerichtet aufs Praktische und im Praktischen verharrend. Der Forschungsdrang der antiken Griechen ging den Römern fast völlig ab. Dennoch müssen wir spätestens hier festhalten, dass nicht nur der historische Charakter Cato diesen Text beeinflusst hat. Cicero gibt auch eigenes hinzu. Zwar ist belegt, dass der an und für sich dem Hellenismus feindlich gegenüber stehende alte Cato noch Griechisch gelernt hat. Dass er aber in einem Gespräch über das Alter nicht nur Plautus und Terenz zitieren würde, sondern auch Sophokles, Pythagoras, Demokrit, Xenophon oder Homer, ist – jedenfalls im vorliegenden Ausmaß – wohl eine Erfindung Ciceros.
Doch das Übermaß an griechischen Referenzpunkten, wie überhaupt der Umstand, dass das ganze Gespräch sehr harmonisch verläuft, inhaltlich wie formal einigermaßen konsistent ist (letzteres kann man zum Beispiel bei Ciceros Gesprächen in Tusculum nicht unbedingt sagen), hat aber einen Grund: Cato maior de senectute orientiert sich an einer berühmten Vorlage. Gemeint ist das einleitende Gespräch zwischen Sokrates und Kephalos, dem alten Vater seines Gastgebers Polemarchos, zu Beginn von Platons Politeia (dt.: Der Staat), wo die beiden über die Vorzüge und Nachteile des Alters diskutieren. Was beim (auch literarisch sehr begabten) Platon nur Vorgeplänkel war, quasi ein Sich-Abtasten der Kämpfer im Ring, hat Cicero zu einem eigenen Text ausgearbeitet.
Da Cicero dabei nicht über das Maß seines eigenen philosophischen Könnens hinausgegangen ist, steht ein recht runder und lesbarer Text vor uns. Natürlich gelingen die ‚Beweise‘ des Cato nur, weil er das im Schlusssatz zu Beweisende schon im Vordersatz versteckt hat. Doch dürfen wir von einem der berühmtesten Rhetoriker und Politiker des Römischen Reichs etwas anderes erwarten?
Cicero: Cato maior de senectute / Cato der Ältere über das Alter. Lateinisch / Deutsch. Übersetzt und herausgegeben von Harald Merklin. Ditzingen: Reclam, 2024. (= RUB 803)