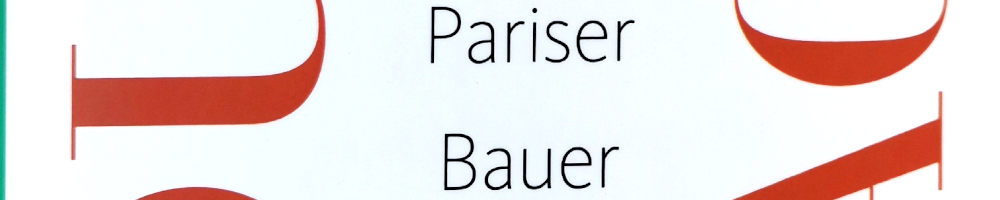… Aragon – der Paysan de Paris, von dem ich des Abends im Bette nie mehr als zwei bis drei Seiten lesen konnt, weil mein Herzklopfen dann so stark wurde, daß ich das Buch aus der Hand legen mußte.
Walter Benjamin – zitiert nach dem hinteren Buchdeckel
Benjamin würde Aragons Roman später kritischer gegenüber stehen, aber er war zweifellos eine der Anregungen und Quellen für sein eigenes Opus magnum infinitum, das Passagen-Werk. Benjamin lehnt sich schon im Titel seiner Arbeit an Aragon an, denn der ganze erste Teil – das sind rund 50 % – des Paysan de Paris (er besteht aus drei Teilen) ist der Passage de l’Opéra in Paris gewidmet, die auch für Benjamins Werk zentral ist. Doch über dieses vielleicht später einmal.
Aber wo beginnen mit einer Vorstellung des Pariser Bauern? Schon die oben verwendete Bezeichnung als ‚Roman‘ beweist große Chuzpe. Denn kann man einen Roman nennen, was zu fünf Sechsteln aus einer Art Spaziergang besteht? Eigentlich sogar aus zwei Spaziergängen, denn im ersten Teil flaniert Aragon als Ich-Erzähler durch die Gegend rund um die Passage de l’Opéra, im zweiten dann zusammen mit seinen Freunden André Breton und Marcel Noll auf den Buttes-Chaumont, einem Park im 19. Arrondissement von Paris. Handlung gibt es da keine; der Text oszilliert zwischen realistischer Schilderung der Umgebung und sich einschleichenden (Alp-)Traumfetzen. Teil 3 gleicht dann den philosophischen Texten der jungen Schlegel und Novalis, insofern als auch Aragon hier in bewusst fragmentarischer Form die Frage diskutiert, wie ein Surrealist und Kritiker des Idealismus Realität nicht nur im Allgemeinen beschreiben sondern auch im Besonderen verändern kann.
Damit kehrt Aragon im theoretischen Diskurs an den Ausgangspunkt des ‚Romans‘ zurück. Dazu muss man wissen, dass 1926, als Paysan de Paris erschien, die Passage de l’Opéra schon nicht mehr existierte. Sie war 1925 abgerissen worden, im Zuge der Verlängerung des Boulevard Haussmann. Dabei verloren viele kleine Handwerker ihre Werkstatt bzw. Verkaufsfläche. Die Kaufangebote für ihre Boutiquen und Wohnungen, die man ihnen machte, waren lächerlich niedrig, mussten aber akzeptiert werden, wollte man nicht eine Konfiskation durch die Stadt riskieren. Vieles in diesem ersten Teil ist daher Nostalgie, aber auch flammender Protest gegen ein solches Vorgehen.
Es ist aber auch ein Spiel mit der Sprache und mit dem Medium Buch. Immer wieder stoßen wir auf Reproduktionen von Plakaten oder Straßenschildern, Preislisten oder Getränkekarten – aber auch den Plan des besuchten Parks im zweiten Teil. Auch Spiele mit Wörtern oder dem Satzspiegel finden wir. Einmal steht zum Beispiel in riesigen Lettern mitten auf Seite 66 der deutschen Übersetzung:
LOUIS!
Ein Ruf, auf den der Autor und Ich-Erzähler sofort reagiert:
Ich komme, ich komme schon: Wer ruft nach mir? Draußen setzt sich das Kommen und Gehen fort. Da ist ja niemand, den ich kenne … ah doch: der Wunsch, meinen Vornamen, der in meiner Umgebung so wenig verwendet wird, in kräftigen Versalien gedruckt zu sehen.
S. 66
Bei allen Abgrenzungen: Der Surrealismus war halt doch ein Kind von Dada …
Die Sexualität, die als Basso continuo den ersten beiden Teilen hinterlegt ist, und hin und wieder (beim Besuch eines Bordells beispielsweise, aber auch bei der Betrachtung hübscher junger Frauen im Park) auch die erste Stimme übernimmt, gibt dem Text eine zusätzliche Dimension, die zwar in ihrer Ausformung zeitbedingt ist, aber dem Ganzen eine gewisse Menschlichkeit verleiht.
Zusammen mit André Bretons Manifest des Surrealismus von 1924 markiert der Pariser Bauer den Anfang dieser Bewegung. Offen gesagt, ist mir diesbezüglich Aragon viel lieber. Dass er 1926, wie Breton und Noll, der Kommunistischen Partei Frankreichs beitrat, anders als seine Freunde aber sein ganzes langes Leben lang Mitglied blieb (was auch die Freundschaft beendete), ja sogar die Bildung einer kommunistischen Geheimpolizei forderte, lässt ihn hingegen in weniger günstigem Licht erscheinen, auch wenn er im Zweiten Weltkrieg als Widerstandskämpfer tätig war.
Louis Aragon: Der Pariser Bauer. Aus dem Französischen von Lydia Babilas. Frankfurt/M: Suhrkamp, 2019. (= suhrkamp taschenbuch 5035). Aktuell nur als Print on Demand erhältlich.