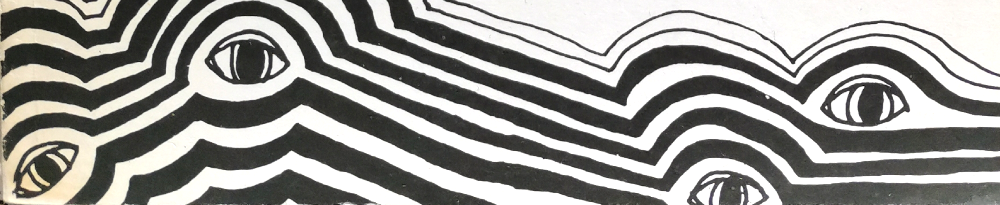John B. Watson prägte den Begriff „Behaviorismus“ und ist auch einer der bekanntesten Vertreter dieses Zweigs der Psychologie. Watson verwendete das Wort zum ersten Mal 1913 in einem kurzen Aufsatz mit dem Titel Psychologie, wie sie der Behaviorist sieht. 1930 erschien dann die endgültige Ausgabe seines Opus magnum, Behaviorismus. In beiden Texten erklärt Watson, warum er mit der damals im Schwang stehenden experimentellen Psychologie an den US-Universitäten nicht glücklich wurde – er nennt William James und John Dewey – und umreißt sein behavioristisches Forschungsprogramm.
Es geht ihm eigentlich darum, dass trotz ‚Experimenten‘ mit teuren Instrumenten die Resultate der Psychologie letzten Endes immer auf Introspektion beruhen. Die Proband:innen erzählen den Experimentator:innen, was sie denken oder fühlen in einer bestimmten Situation. Oft sind auch Proband:in und Experimentator:in identisch. Das macht in Watsons Augen diese Experimente unbrauchbar, weil ihre Resultate nicht oder nur schwierig und teilweise reproduzierbar sind. (Das ist, nebenbei, auch sein Hauptargument gegen die Psychoanalyse als Wissenschaft, auf die er einmal nebenbei zu sprechen kommt.)
Die Resultate der Experimente müssen nach Watson ohne weitere Rücksprache ersichtlich sein. Für ihn gibt es in diesem Fall nur einen Weg: Er nimmt einen Reiz, den er auf einen Körper ausübt und notiert dessen Reaktion. Natürlich sind es nicht die einfachen Reiz-Reaktions-Mechanismen, die ihn interessieren, wie der Umstand, dass ein Kind sofort seine Hand zurückziehen wird, wenn es eine heiße Herdplatte berührt. Es geht ihm darum, dass so ein Mechanismus auch konditioniert werden kann. Will sagen: Ein natürlicher Reiz-Reaktions-Ablauf wie der Umstand, dass ein hungriger Mensch ebenso wie ein hungriger Hund vermehrten Speichelfluss zeigt, wenn er Nahrung erblickt, kann konditioniert werden, indem jedes Mal, wenn zum Beispiel dem Hund Futter gegeben wird, ein bestimmtes Geräusch ertönt. Irgendwann wird der Hund schon zu speicheln beginnen, wenn er nur schon das Geräusch hört (Pawlow).
Neu ist, dass Watson das ganze menschliche Verhalten als Abfolge von konditionierten Reizen betrachtet. Das hat für ihn den Vorteil, dass er das leidige Leib-Seele-Problem gelöst bzw. besser gesagt in Nichts aufgelöst hat: Es gibt nur den Leib. Oder, mit anderen Worten: Die Psychologie ist für ihn ein Zweig der Biologie.
So weit, so interessant. Das Problem seines Textes ist, dass zwar die Konditionierung einer einzigen und einfachen Reaktion à la Pawlow problemlos möglich und beschreibbar ist. Sobald aber längere Ketten von solchen konditionierten Reaktionen auftreten, geht das nicht mehr, und Watson begnügt sich damit, festzuhalten, das sei gerade zu kompliziert, um es hier auszuführen. Auch verwendet er den Reiz-Reaktions-Mechanismus oft genug für in sich zusammengesetzte Reaktionen, die er als eine einzige Reaktion betrachtet.
Wir finden also einige gute oder zumindest interessante Ideen. Leider argumentiert Watson oft sehr apodiktisch, was seine Akzeptanz bei Kolleg:innen nicht erhöht hat. So behauptet er, dass, wenn man ihm ein Dutzend Jungs zur Verfügung stellen würde, die in einem völlig neutralen (= reizlosen) Umfeld aufgewachsen sind, er durch bloße Konditionierung aus jedem machen könnte, was gewünscht wäre: Arzt oder Fußballspieler, Dichter oder Arbeiter. Das klingt nicht sehr schön, ist aber hier sogar gut gemeint, weil sich Watson damit gegen jene anhebende Welle der Eugenik wendet, die ‚minderwertiges‘ Menschenleben wenn nicht gleich auslöschen, so doch an einer Fortpflanzung hindern wollte. Es gibt für Watson als Wissenschaftler keine erblichen Unterschiede, sondern nur die durch unterschiedliche Konditionierung hervorgerufenen.
Ein anderes Mal kritisiert er die Einführung der Prohibition in den USA als ein soziales Experiment, das durchgeführt wurde ohne genügende Vorbereitung. Man habe gleich jede Menge an Parametern geändert, und wundere sich nun, dass nicht nur die erhoffte positive Auswirkung ausbleibe sondern sogar bedeutende negative aufgetaucht seien. Er ist aber in seinem Buch nicht konsequent. So ist es seiner Meinung nach kein Problem, die etwa 5 % Linkshänder, die es seiner Schätzung nach gibt, auf ‚rechts‘ umzukonditionieren. Warum man das überhaupt tun sollte – diese Frage stellt er sich offensichtlich nicht. Ähnliches gilt für sein – in einem anderen Werk, nicht in diesem hier – aufgestelltes pädagogisches Programm, wo er fordert, dass Kinder noch vor ihrem 7. Lebensjahr der Obhut der Mutter entzogen werden, denn Mutterliebe mache das Kind abhängig und hindere es daran, die Welt zu erobern. Seiner Ansicht nach schränken übermäßige Liebkosungen das psychische Wachstum ein und behindern spätere Erfolgschancen. (Seine drei Kinder von zwei Frauen waren alle suizidgefährdet, was mich nun irgendwie nicht wundert.) Hier hat Watson ganz eindeutig – wie die USA mit der Prohibition – ein Experiment durchgeführt, bei dem der Experimentator zu viele Faktoren aufs Mal geändert haben wollte und das deshalb zum Scheitern verurteilt war.
Eine krude Mischung von Rechthaberei und interessanten Einsichten. Ein Buch, das kritische Lesende verlangt.