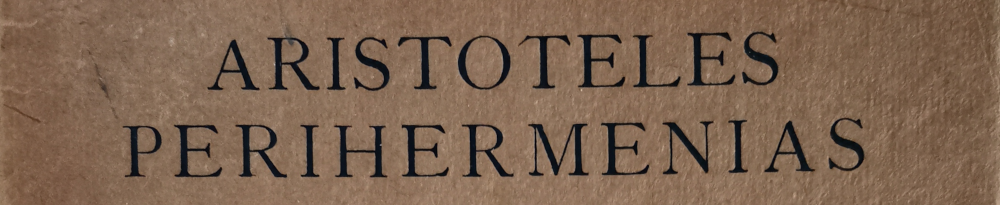Auch der zweite Teil des Organon von Aristoteles ist seiner Form nach eher eine Art Manuskript zu einer Vorlesung gewesen oder ein Textbuch für ein ‚Oberseminar‘ mit seinen Studenten. Zur Veröffentlichung war er wohl nie gedacht; zu wenig ausgeführt sind die Argumente. (Dass das Organon als Ganzes eine spätere Zusammenstellung von solchen Texten ist, und auch eine Zusammenstellung ohne Rücksicht auf die Entstehungszeit, sondern nur der Versuch einer thematischen und nachträglichen Anordnung von aufgefundenen Texten, zeigt schon der Umstand, dass sich Aristoteles im vorliegenden zweiten Teil in einer Vergangenheitsform – sinngemäß: Wir haben schon in der Topik gesehen … – auf einen weiter hinten, als fünften Teil eingeordneten Text bezieht.)
Περὶ ἑρμηνείας, (perí hermēneías – in der lateinischen Übersetzung De interpretatione), bedeutet wörtlich übersetzt „Von der Deutung“. Das trifft auch besser, was Aristoteles in dieser Schrift versucht; es geht hier nämlich nicht nur, aber natürlich auch, um den „Satz“.
Zunächst einmal aber klärt Aristoteles ein paar erkenntnistheoretische Voraussetzungen des Satzes. Es gibt, so der Philosoph, Dinge, oder Gegenstände. Von diesen wiederum gibt es Abbildungen in den Seelen der Menschen; Aristoteles nennt diese Vorstellungen. Ein Laut (oder Wort) ist ein Zeichen (Symbol) für eine solche Vorstellung. (Und etwas Geschriebenes ist wiederum ein Zeichen für Laute.) Wir sehen, wie sich bei Aristoteles die Erkenntnistheorie mit der Zeichentheorie mischt.
Erst nachdem diese Voraussetzungen geklärt sind, geht Aristoteles dann zum Satz über. Das heißt: Zunächst definiert er die Bestandteile des Satzes. Er kennt ein Hauptwort (Substantiv) und ein Zeitwort (Verb), die zusammen den Satz bilden. Das weitere Zugemüse, das die heutigen Grammatiken kennen, vernachlässigt er, oder er subsummiert solche Wörter unter die Haupt- oder Zeitwörter.
Am meisten interessieren Aristoteles in der Folge Sätze von der Form „A ist b“ – „Sokrates ist weiß“. Diese werden nun durch sämtliche Möglichkeiten hindurch ‚dekliniert und konjugiert‘. Bejahung und Verneinung, allgemeine und besondere Aussagen, modale Aussagen und welche, die nicht in der Gegenwart formuliert sind etc. etc. Alle diese Möglichkeiten, und das ist, wenn ich das richtig sehe, in dieser Konsequenz etwas, das Aristoteles neu in die Philosophie / Logik eingeführt hat, werden immer daran gemessen, ob und wie sie wahr sind bzw. eine Wahrheit ausdrücken können. Aristoteles verwendet dabei ganz naiv und unhinterfragt die ihm wohl intuitiv einleuchtende Korrespondenztheorie der Wahrheit: Wahr ist, was der Fall ist. Ebenso wie die Vorstellungen der Dinge in der Seele nimmt er diese Wahrheitstheorie als gegeben an.
Bei der Negation allerdings kennt er verschiedene Varianten, denen er verschiedene Bedeutung zuordnet. Der Satz „Jeder Mensch ist weiß“ hat nämlich gemäß dem Περὶ ἑρμηνείας verschiedene mögliche Negationen: „Kein Mensch ist weiß“, „Jeder Mensch ist nicht weiß“ und „Jeder Mensch ist nichtweiß“. Er unterscheidet dies vor allem formal und geht auf weitere Implikationen nicht mehr ein. Hier betritt er auch das Gebiet der heute so genannten modalen Logik.
Vor mir liegt eine mir vor Jahrzehnten zugelaufene, mittlerweile über 100 Jahre alte antiquarisch erworbene Ausgabe:
Aristoteles: Perihermenias oder Lehre vom Satz (Des Organon zweiter Teil). Neu übersetzt und mit einer Einleitung und erklärenden Anmerkungen versehen von Dr. theol. Eug. Rolfes. Leipzig: Felix Meiner, 1920. (= der philosophischen Bibliothek Band 9). [Der Text wurde dort noch so spät wie 1972 im Nachdruck herausgegeben. Heute ist der zweite Teil des Organon bei Meiner nur noch, zusammen mit den Kategorien in einer zweisprachigen Ausgabe als Print-on-Demand in Band 493 der Philosophischen Bibliothek greifbar, herausgegeben von Hans Günter Zekl, unter dem Titel Hermeneutik oder vom sprachlichen Ausdruck, was – zumindest der erste Teil Hermeneutik – nun auch wieder nicht ganz korrekt ist. So etwas wie „Zeichen- und Satzlehre“ würde den Inhalt des kurzen Textes wohl am besten treffen.)