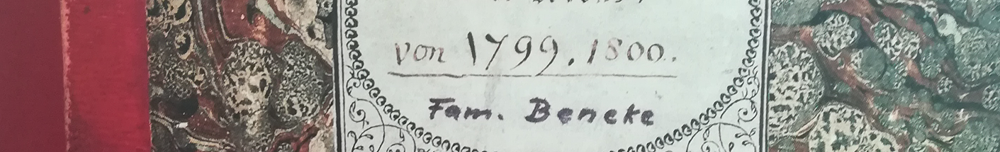Überraschung! Damit hatte ich nicht mehr gerechnet und war entsprechend sogar etwas erschrocken, als ich das riesige, schwere Paket öffnete, das mir meine ehemalige Buchhandlung zugeschickt hatte. Offenbar hat der Wallstein-Verlag nun nach Jahren gerade zwei seiner großen Reihen bzw. Werkausgaben weitergeführt. Ich hatte damals einige einigermaßen kryptische Bemerkungen im Anschluss an die II. Abteilung der Beneke-Tagebücher dahingehend verstanden, dass der IV. Teil nur noch elektronisch erscheinen würde.1) Nicht einmal die Mühe, die Reihe zu stornieren, hatte ich mir in meiner damaligen Enttäuschung genommen. Nun, da die drei Bände Tagebücher, die vier Bände Beilagen (jeweils von Beneke selber dem Tagebuch beigefügt) und der eine Band mit Zeitleiste und Anhängen des Herausgebers doch noch auf Papier erschienen sind, werde ich Dich, geneigtes Publikum, davor nicht verschonen können.
Stellen wir kurz den Zusammenhang her – der letzte Tagebuchband der III. Abteilung endete ja, trotz der stattgefundenen Bestallung als Oberaltensekretär (sein Traumjob!), eher in einer gedämpften Moll-Tonart. Ich zitiere mich selber:
Das Jahresende 1816 – wie jedes Kalenderdatum ein willkürlicher Einschnitt – sieht Beneke als wohlbestallten Oberaltensekretär, leidend aber, mit einer ebenfalls leidenden Frau (Beneke und der Hausarzt sind sich nicht sicher, ob sie zum vierten Mal schwanger ist) und einer langsam zum Tode dahin siechenden Mutter. Kein Wunder, sieht der Mann schon wieder alles schwarz.
Schon 1817 ist die Schwangerschaft offenbar definitiv bestätigt. Zum im Frühjahr zur Welt kommenden Sohn wird sich später im ersten Band der III. Abteilung auch noch eine weitere Tochter gesellen, was die Familie bis 1820 auf sieben Köpfe wachsen lässt. Allerdings stirbt die im selben Haus lebende Mutter Benekes wirklich noch im Jahr 1817. Sein 1816 gezeugter Sohn lässt sich seinerseits ungebührlich viel Zeit damit, zur Welt zu kommen. Beneke möchte eigentlich daheim sein, wenn er geboren wird, müsste / sollte / möchte aber auch eine Badekur wegen seiner Füße unternehmen. Schließlich reist er vor der Geburt ab, verzweifelt aber wieder einmal am langsamen Briefverkehr.
Benekes Badekur ist dann auch das vielleicht interessanteste Ereignis, das Band IV/1 zu bieten hat. Weniger berühmter Leute wegen, die er trifft – da ist Hardenberg (Bruder des verstorbenen Novalis) der bekannteste Name. Interessant ist die Badekur zunächst wegen der von Beneke notierten Gespräche. Zwei Mal – einmal mit eben jenem Hardenberg, einmal mit einem Benediktinermönch – diskutiert der stramme, aber in theologicis extrem konservativ denkende Protestant Beneke über die Differenzen zwischen Katholizismus und Protestantismus. Vor allem der Mönch scheint ihn mit seiner Meinung zu beeindrucken; bei Hardenberg hingegen moniert er einen übertriebenen Bekehrungseifer. (Dass er den seinerseits, vor allem im Jahr 1817, ebenfalls an den Tag legt, fällt ihm natürlich nicht auf.) Auch erschauern wir wohl heute bei der Badekur, trotz eigentlich recht oberflächlichen Beschreibung, die uns Beneke gibt. Die Kranken müssen fassweise Wasser trinken, ohne dass die Ärzte überhaupt eine Ahnung haben, wie das auf die Krankheit wirklich wirkt. Als die Kur bei Beneke nicht gleich anschlägt, behauptet der Badearzt, schon immer gesagt zu haben, dass die in Beneke steckende Krankheit sich zuerst ganz entwickeln müsse, bevor sie bekämpft werden könne. Immerhin ändert er seine Verschreibung dahin gehend, dass Beneke nun zuerst das Wasser trinken solle und dann erst seinen Morgenkaffee …
Ansonsten verzweifelt Beneke nicht nur am langsamen Briefverkehr sondern auch an der Politik, insbesondere der Hamburger Bürgerschaft. Dabei ist seine eigene Position nicht ohne Widersprüche. Einerseits sehr deutschnational gesinnt (was seine Freundschaft mit Fouqué beweist oder der Umstand, dass sein unterdessen sechs Jahre zählender Ältester – nach Jahn turnen geht), will er dennoch das „alte Hamburg“, die Verhältnisse von vor der napoleonisch-französischen Besetzung, wieder hergestellt wissen und beäugt Preußen mit seinen hegemonialen Ansprüchen ebenso misstrauisch wie die Karlsbader Beschlüsse, in denen er vor allem den Versuch Preußens sieht, seine Vormachtstellung im deutschen Bund zu befestigen.
Alles in allem aber ist Beneke als Politiker doch recht naiv. Da wünscht er sich zur Bekämpfung der Sklaverei (also zu einem eigentlich durchaus zu befürwortenden Zweck), dass sich sämtliche europäischen Staaten zusammentun und – Afrika kolonialisieren sollten. Die darin steckende herablassend-paternalistische Haltung gegenüber den Einheimischen ist zeittypisch, und dass er durch seine Idee den Teufel mit Beelzebub austreiben würde, scheint ihm nicht bewusst gewesen zu sein, obwohl es damals schon Stimmen gab (zum Beispiel Alexander von Humboldt, den Beneke nicht zur Kenntnis zu nehmen scheint), die darauf verwiesen.
Seine Lektüre notiert Beneke nach wie vor. Da sind die neuesten Werke von E. T. A. Hoffmann, obwohl er sie nicht mehr so gut findet wie die früheren. Jean Paul, obwohl er nicht mehr in Kontakt steht mit ihm, liest er noch fleißig und vergleicht sich gar selber mit Wutz. Manche seiner Lektüren bzw. Reaktionen darauf wirken eher seltsam. So kann der Nationalist Beneke nichts anfangen mit der Nibelungensage. Er mag die Preußen nicht, lobt aber Lessings Freund Ewald von Kleist. Lessings eher weltliche Einstellung in Sachen Religion ist ihm zuwider und er hofft, dass Gott dem Verstorbenen nun die Wahrheit gezeigt habe. Er ist als Hamburger stolz auf den Mitbürger Hagedorn, liest aber lieber katholische Eiferer wie Görres oder Friedrich Stolberg. Bei Goethes Divan kann sogar er nicht umhin, die ganz große Literatur darin zu fühlen, spült das Buch dann aber doch lieber mit einem Text von Kotzebue herunter.
Summa summarum liefert Band IV/1 der Beneke-Tagebücher einen entlarvenden Eindruck in das deutsche Bürgertum während der Restaurationszeit. Gut meinend, aber oft dumpf miefend, steht dieses hier vor uns – umso seltsamer eigentlich, dass es erst ein halbes Jahrhundert her ist, dass Hamburg noch eine weltoffene Stadt war, deren Bürger:innen (man denke an Meta Klopstock) zwar durchaus christlich sein konnten, aber den Tatsachen der großen Welt deswegen nicht ablehnend und fremd gegenüber standen.
1) Zur Erinnerung, weil ich selber auch nachschauen musste: Die Herausgebenden der Tagebücher haben – nach der I. Abteilung mit den Tagebüchern des jungen Mannes – damals die III. Abteilung vor der II. veröffentlicht; wenn ich mich recht erinnere, weil sich im Zeitrahmen der Tagebücher der III. Abteilung die Befreiung Hamburgs von der napoleonisch-französischen Besatzung abspielte. In der Zeit der Befreiungskriege spielte Beneke eine nicht unbeträchtliche Rolle; auch jährte sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der III. Abteilung die Befreiung gerade zum 200. Mal.
- Ferdinand Beneke (1774-1848). Die Tagebücher. IV/1. Tagebücher 1817-1820. Im Auftrag der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur herausgegeben von Ariane Smith (Projektleitung),Viktoria Bertheau, Juliane Bremer, Jan-Christian Cordes, Frank Eisermann, Angela Schwarz und Anne-Kristin Voggenreiter. Unter wissenschaftlicher Beratung von Franklin Kopitzsch. Göttingen: Wallstein, 2025.