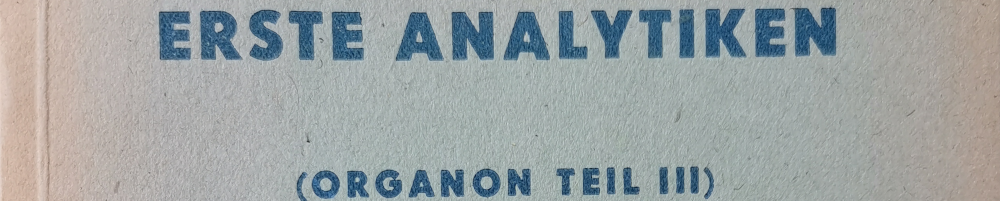Mit seiner Lehre vom [logischen] Schluss, der Analytica priora, hat Aristoteles die Logik als Methodik überhaupt erst ins wissenschaftliche und philosophische Denken eingeführt. Allerdings ist er noch weit entfernt vom puren Spiel der Schlussarten, den die Scholastiker daraus gemacht haben – hier finden wir noch keine BARBARA, keinen CELARENT und wie die Kollegen später alle hießen. Für Aristoteles ist die Lehre vom Schluss auch nicht einfach ein intellektuelles Spiel. Er verfolgt bei der Festlegung dessen, was ein Schluss ist und wie er zu Stande kommt, ein ganz bestimmtes Ziel.
Im Grunde genommen betreibt der Stagirit hier nämlich Wissenschaftstheorie und -methodik. Es geht Aristoteles darum, festlegen zu können, wann der Wissenschaftler / Philosoph aus seinen Beobachtungen zu Recht auf ein dahinter stehendes Phänomen als Erklärung schließen kann. Das ist weder von der Darstellung noch vom Inhalt her schon das, was das Mittelalter und auch die Neuzeit bis auf Frege und Russell unter ‚Logik‘ verstanden haben. Einzig der Umstand, dass schon die Analytica priora je einen Vor-, einen Mittel- und einen Schlusssatz kennt (und genau nur drei Teile!), findet sich schon beim alten Griechen. Aber Aristoteles schraubt an allen drei Sätzen herum, um zu sehen, ob ein Schluss möglich ist, ob der Schluss (wenn er denn möglich ist) allgemein gültig ist oder nur partiell, ob man ihn verneinen kann und wenn ja, wie. Das macht seine Analytica priora gleichzeitig komplexer und ‚unlogischer‘ als die späteren Ausarbeitungen.
Dass er dabei mit seinen Beispielen die heute gültige saubere Trennung von epistemologischen Aussagen und ontologischen nicht durchführt, kann nicht verwundern Es fehlte ihm noch an allen Ecken und Enden an Untersuchungen, ja am Wortschatz dafür. So finden wir Schlüsse, die eher semantische Probleme zu lösen versuchen und andere, die sich mit ethischen Fragen beschäftigen, neben rein logischen. Das Problem der Wahrheit blitzt ebenfalls auf, aber was ‚Wahrheit‘ genau ist, lässt Aristoteles offen, bzw. ist für ihn wohl selbstverständlich: Ein Satz ist wahr, wenn er der Wirklichkeit entspricht.
Dennoch: Wir haben hier den Ahnherrn der Logik vor uns, und es ist erstaunlich, was Aristoteles ohne mathematische Hilfsmittel zu Stande gebracht hat.
Vor mir liegt eine mir vor Jahrzehnten zugelaufene, in Teilen mittlerweile über 100 Jahre alte antiquarische Ausgabe:
Aristoteles: Lehre vom Schluss (Des Organon dritter Teil) oder Erste Analytik. Neu übersetzt und mit einer Einleitung und erklärenden Anmerkungen [die man sich heute schenken kann, Rolfes versteht weniger von Logik als Sie oder wir] versehen von Dr. theol. Eugen Rolfes. Leipzig: Felix Meiner, 1948. (= Unveränderter Abdruck der Auflage von 1921).
[Offenbar war der Buchblock noch vorhanden, aber die Buchdecken mussten neu erstellt werden. Wer hier geschlafen und aus einer einzigen Ersten Analytik des Aristoteles in der Mehrzahl Erste Analytiken gemacht hat, lässt sich wohl nicht mehr rekonstruieren. Ich vermute, dass man 1948 froh sein musste, überhaupt drucken zu dürfen und Papier zu haben. Es war wohl weder Geld noch Material vorhanden, die Buchdecke noch einmal zu drucken und die alte einzustampfen. Falls man den Fehler überhaupt bemerkte. – Habent sua fata libellis.]