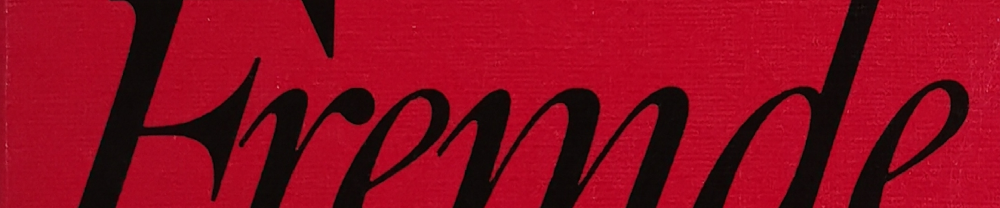Die Sonne sei schuld, meint Meursault vor Gericht, als er gefragt wird, warum er nicht nur einmal auf den Araber geschossen habe, sondern nach kurzem Warten gleich das ganze Magazin in den Körper des offenbar doch schon Toten geballert. Die Frage hat oberflächlich gesehen den juristischen Zweck, zwischen Notwehr (der Araber hatte ein Messer dabei) und vorsätzlicher Tötung zu unterscheiden, was natürlich das Strafmaß beeinflussen würde. Die Schuld daran der Sonne zuzuweisen, scheint auf den ersten Blick recht absurd und wird vom Gericht auch so aufgefasst. Nun wissen zwar alle, die sich schon einmal im Mittelmeerraum aufgehalten haben, dass die Sonne da tatsächlich mörderisch herunterbrennen kann – aber die dortigen Einwohner sollten das ja eigentlich wissen. Und Meursault ist offenbar im damaligen Französisch-Algerien zur Welt gekommen.
Tatsächlich empfindet Meursault anders als andere, nimmt Dinge anders wahr als andere. Er ist der im Absurden lebende Mensch schlechthin. Zu Beginn des Romans und noch bis weit in den zweiten Teil hinein ist er sich dessen gar nicht bewusst. Erst gegen Ende erkennt er es. Hierin gleicht er Sisyphos im Buch, das Camus gleichzeitig zum Fremden schreibt. Ich komme noch dazu.
Der Beginn des vorliegenden Romans ist einer der berühmtesten Roman-Anfänge der französischen Literatur überhaupt:
Aujourd’hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J’ai reçu un télégramme de l’asile : “Mère décédée. Enterrement demain. Sentiments distingués.” Cela ne veut rien dire. C’était peut-être hier. [In der Übersetzung meiner Ausgabe: „Heute ist Mama gestorben. Vielleicht auch gestern, ich weiß es nicht. Aus dem Altersheim bekam ich ein Telegramm: «Mutter verschieden. Beisetzung morgen. Vorzügliche Hochachtung.» Das besagt nichts. Vielleicht war es gestern.“]
So kurz der erste Satz des Romans ist, so unübersetzbar ist er in eine Sprache, die keine Tochter des Latein ist. Maman est morte ist nämlich zweideutig. Einerseits heißt das tatsächlich: „Mama ist gestorben“, andererseits aber auch „Mama ist tot“. In dieser Ambivalenz zwischen gerade beendetem Ereignis und schon lange vollendeter Tatsache nun lebt der Ich-Erzähler Meursault sein ganzes Leben. Dadurch ist es ihm beim Begräbnis der Mutter nicht möglich, Trauer zu empfinden oder gar zu zeigen. Von dem Moment an, an dem seine Mutter gestorben ist, ist sie für ihn schon lange tot. Deshalb kann er sich nicht einmal mehr an ihr Alter erinnern.
Deshalb ist auch die Sonne schuld am toten Araber. Sie hat mit ihren Strahlen für einen kurzen Augenblick das Messer des Mannes aufblitzen lassen. Dieser Augenblick war offenbar zu kurz, um in Meursaults Weltbild des „Gleichzeitig-gerade-Beendeten und Doch-schon-lange-Vollendeten“ integriert werden zu können – und so agiert er ganz gegen sein sonstigen Wesen für einmal. Er, der sonst nur reagiert. Vor- wie nachher wird er durch seine Disposition als völlig gefühlloses Wesen wahrgenommen. Selbst als ihn bei der Untersuchung der Staatsanwalt mit dem in seinem Büro hängenden Christus am Kreuz konfrontiert, reagiert Meursault nicht. Alle anderen, so der Staatsanwalt, wären in diesem Moment zusammengebrochen und hätten gebeichtet. Er hält deshalb Meursault für einen ganz verstockten Atheisten – obwohl der auf Grund seiner Disposition selbst in dieser Frage keine Stellung bezieht, beziehen kann.
Camus hat parallel zu diesem Roman auch an seinem philosophischen Essay Der Mythos von Sisyphos gearbeitet. Er legte Wert darauf, beide Werke nicht als existenzialistisch betrachtet zu sehen, sondern als eine Darstellung des absurden Lebens, das wir alle führen. Ähnlich wie sein Sisyphos die Erfüllung seines Lebens, bzw. den Ausweg aus dessen Sinnlosigkeit, darin erblickt, die Götter auszutricksen und den Stein mit Freude immer wieder den Berg hoch zu wälzen, wird Meursault in seiner letzten Nacht
… empfänglich für die zärtliche Gleichgültigkeit der Welt. Als ich empfand, wie ähnlich sie mir war, wie brüderlich, da fühlte ich, daß ich glücklich gewesen war und immer noch glücklich bin. Damit hat sich alles erfüllt, damit ich mich weniger allein fühle, brauche ich nur noch eines zu wünschen: am Tag meiner Hinrichtung viele Zuschauer, die mich mit Schreien des Hasses empfangen.
Das ist dann auch das Ende des Romans. Gegen den Strich zu leben, dürfen wir schließen, ist die Erfüllung des Lebens.
Albert Camus: Der Fremde [L’Étranger]. Übertragen ins Deutsche von Georg Goyert und Hans Georg Brenner. Reinbek: Rowohlt, Juli 1969. [Vor mir liegt das 702. Bis 716. Tausend, August 1987. Der Roman ist 1942 zum ersten Mal auf Französisch erschienen und seither einer der meistgelesenen französischen Romane geworden.]