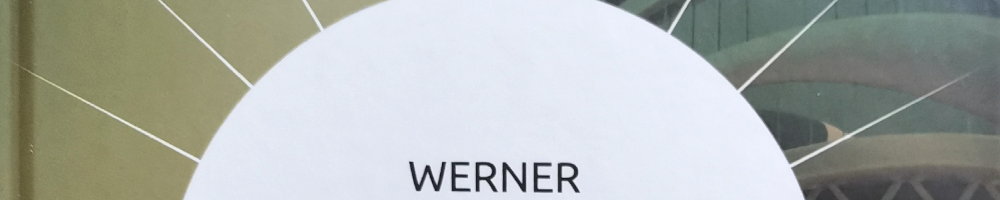Gut so. Die Reihe Wiederentdeckte Schätze der deutschsprachigen Science Fiction im Berliner Verlag Hirnkost scheint sich zu berappeln. Nachdem die beiden vorletzten Bände der Reihe nichts mit Science Fiction zu tun hatten sondern reine politische Utopien bzw. Dystopien waren, dazu noch von literarisch mediokrer Qualität, war bereits der Vorgänger des neuesten Stücks aus der Reihe, des vorliegenden Utopolis von Werner Illing, nämlich Paul Gurks Tuzub 37, wieder sehr interessant – ‚echte‘ Science Fiction und auch literarisch ansprechend. Der Band mit Werner Illings Utopolis schließt sich in jeder Hinsicht nahtlos an.
Allerdings muss ich eine Einschränkung machen. Dafür werfen wir aber zuerst einen Blick auf das Buch als ganzes. Es enthält nämlich nicht nur den titelgebenden Roman sondern auch eine Reihe von Kurzgeschichten Illings, die mehr oder weniger dem phantastischen Genre bzw. der Science Fiction, zugeordnet werden können. Und nun haben wir hier das Phänomen vor uns, dass in diesem Buch nicht der titelgebende Roman literarisch und inhaltlich am besten gelungen ist, sondern die besten Texte erst in den Kurzgeschichten zu finden sind.
Das hängt auch mit der Entstehungsgeschichte von Utopolis selber zusammen. Der Roman war eine Auftragsarbeit und erschien zunächst 1930 in einer sozialdemokratischen Zeitschrift. Illing sollte später selber zugeben, dass die Erzählung ein wenig – ich paraphrasiere – zu stramm auf der parteipolitischen Linie liegend geraten war. (Illing spricht gar von kommunistisch – was gar nicht so falsch ist. Eine ideologische Differenz zum Kommunismus kann ich jedenfalls nicht erkennen – im Gegensatz zum Verfasser des Nachworts, Joachim Ruf.) Sprachlich ist die Geschichte sauber, ohne jetzt umwerfend zu sein. Auch Science Fiction-Elemente, z.B. Hypnosestrahlen, kommen vor.
Erzählt wird die Geschichte in der Ich-Form von einem jungen Mann, der zusammen mit einem anderen Matrosen nach einem Schiffbruch auf einer Insel angespült wird. Wobei nicht klar ist, ob es sich beim Ich-Erzähler wirklich um einen Matrosen handelt. Im Gegensatz zu seinem Kollegen, der alle Züge eines Matrosen aufweist, wie man sie damals beispielsweise von Kuttel Daddeldu kannte (er trinkt gern Alkohol und ist auch seiner Verlobten in der Heimat offenbar nicht so ganz treu – allerdings bessert er sich in Utopolis rapide), scheint der Erzähler über eine gutbürgerliche Ausbildung zu verfügen.
Die beiden Schiffbrüchigen werden von in der Nähe des Strandes lebenden Menschen gefunden und in ihre Gemeinschaft aufgenommen. Die Menschen auf dieser Insel (oder ist es ein Kontinent? – hier bleibt Illing vage) leben in einem Staatsgebilde, das die kommunistische Utopie der Gleichheit und Freiheit aller Menschen verwirklicht hat. Die Arbeit ist nicht mehr entfremdet, man produziert nicht über Bedarf hinaus, Luxusgüter sind unbekannt, die Frauen haben die gleichen Rechte und Pflichten wie die Männer etc. etc. Nur am Rand dieses utopischen kommunistischen Staats leben ein paar unverbesserliche Kapitalisten in einer eigenen Stadt.
Der Roman handelt dann davon, dass diese Kapitalisten einen Hypnosestrahl entwickeln, mit dem sie die Bevölkerung des kommunistisch-utopischen Staates dahingehend beeinflussen, dass sich diese (wieder) nach kapitalistischem Firlefanz wie prestigeträchtigen Ämtern, einem alles lenkenden lieben Gott und billigem kapitalistischen Tand sehnen. Die Realisierung dieser Gelüste führt dazu, dass im einst utopischen Staat nunmehr alle statt in kleinen, aber hellen Häuschen in schlecht gebauten und stinkenden Mietskasernen leben. An die Stelle freien und selbstbestimmten Lebens an der frischen Luft tritt ein schmutziges Saufen und Huren. (Es ist für mich immer wieder verblüffend, wie gerade sozialdemokratische und kommunistische Ideologien zu einer ungeheuer rigiden, protestantischen Ethik neigen.)
Das Ganze hat natürlich ein Happy Ending: Unser Schiffbrüchiger kann praktisch im Alleingang die Kapitalisten stoppen. Die abtrünnig gewordenen Genossen und Genossinnen bereuen und kehren in den Schoss der Partei … äh … des utopischen Staates zurück. Last but not least kriegt der Ich-Erzähler auch die geliebte Frau (obwohl zu Beginn des Romans, bei der Einführung der beiden Matrosen in dieses utopische Gesellschaftswesen, betont wurde, dass reine Pärchen-Beziehungen in diesem Land nicht mehr existierten).
Sprachlich ist der Roman sauber ohne zu überragen. Inhaltlich ist er, wie wohl schon die kurze Zusammenfassung oben gezeigt hat, mit dem Holzhammer konstruiert. (Illing hat das, wie auch schon gesagt, später selber zugegeben.) Bestünde der vorliegende Band der Reihe Wiederentdeckte Schätze der deutschsprachigen Science Fiction nur aus diesem einen Text, müsste man Illing bestenfalls als einen Schriftsteller abnicken, der es zwar gut meinte, aber nicht gut konnte.
Es folgen aber auf die rund 150 Seiten des Romans noch einmal etwa gleich viele mit diversen Kurzgeschichten des Autors. Und in diesen zeigt sich Illing als Schriftsteller von einigem Können. Ein paar expressionistisch-symbolistisch angehauchte Texte machen den Anfang. Illing besaß offenbar ein großes Talent für phantastische Geschichten, die er mit einiger Ironie vortrug – ein größeres Talent jedenfalls als für die eigentliche Science Fiction. Abstriche sind zwar zu machen: So versteckt sich in den Kurzgeschichten auch jene eine, 1949 erschienene, aber bereits 1948 mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle verfilmte mit dem Titel Der Herr vom andern Stern. Die Geschichte ist nett, die Moral davon auch – wie gemacht für unterdessen einen die Rolle des listigen Saubermannes besetzenden Heinz Rühmann (was sie denn wohl auch war). Überragend ist auch diese zweite Science Fiction-Geschichte des Buchs nicht.
Wir sind nicht nervös hingegen könnte direkt von Paul Scheerbart stammen mit ihrem verspielten Nonsense. In Der Modellmensch steckt die Frage nach der Optimierung des Menschen durch die Maschine bzw. als Maschine, wie sie heute als „Transhumanismus“ von gewissen Philosophen diskutiert wird. Andere Geschichten weisen eher märchenhaften Charakter auf oder sind in phantastischer Form als Parabeln auf die menschliche Existenz angelegt. Sie faszinieren alle durch ihre verspielte Fabulierfreude.
Am Schluss der Kurzgeschichten findet sich ein Text, der keine eigentliche Kurzgeschichte darstellt. Es handelt sich um einen Rückblick des mittlerweile 80-jährigen Illing auf sein Leben, der beginnt mit dem Satz Als Kind ging mich das Sterben nichts an. Bald darauf meint er: Später geriet man mit dem Tod in eine gewisse Intimität. Erst der nunmehr alte Mann akzeptiert (mit einem Goethe-Zitat), dass der Tod Teil des Lebens ist. Ein sehr ergreifender und sehr kluger Text.
Werner Illing: Utopolis. Herausgegeben von Hans Frey † 2024 und Klaus Farin. Berlin: Hirnkost, 12025.