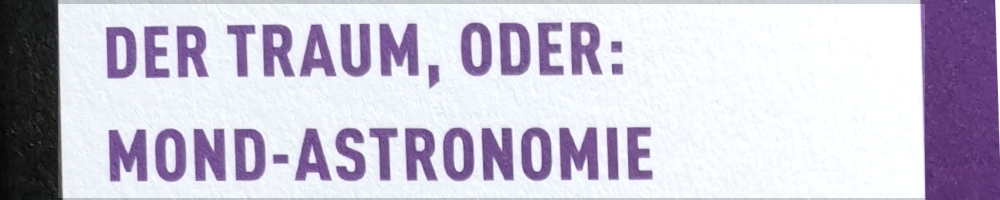Daran, dass Johannes Kepler eine Science Fiction-Geschichte geschrieben hatte, glaubte ich mich erinnern zu können. Dennoch war es Hans Frey mit seiner Geschichte der deutschen Science Fiction, der sie mir dann wieder ins Gedächtnis zurückgerufen hatte. Immerhin ist Kepler ein Beispiel früher Science Fiction überhaupt, deutscher Science Fiction sowieso – dazu stammt der Text dann noch von einem der frühesten und besten Astronomen der Wissenschaftsgeschichte. Wobei sowohl das Deutsche an dieser Geschichte wie das Fiktionale daran cum grano salis verstanden werden müssen.
Deutsch ist die Geschichte insofern, als Johannes Kepler in Deutschland geboren ist und sein Leben vorwiegend im deutschen Sprachraum verbracht hat. Geschrieben wurde sie allerdings in der damaligen Sprache der Wissenschaft, Latein. Zum Zeitpunkt der Abfassung hielt sich Kepler in Prag auf – das allerdings damals über einen großen deutsch sprechenden Bevölkerungsanteil verfügte.
Fiktion wieder ist der Text vor allem zu Beginn, wo ein Ich-Erzähler davon erzählt, wie er auf der Heimreise von der Frankfurter Buchmesse bei einer Übernachtung in einem Gasthaus davon träumte, sein an der Messe erworbenes Buch zu lesen, in dem ein Isländer namens Duracotus seine Lebensgeschichte erzählt. Eine dreifache Verschachtelung des Erzählers also: reales Ich, Traum-Ich und Duracotus. In des letzteren Lebensgeschichte greift nun ein Dämon ein, der ihn und seine Mutter, eine zauberkundige alte Frau, auf den Mond transportiert. Dort kann Duracotus feststellen, dass der Mond bewohnt ist.
Es ereignen sich aber bei Keplers Mondreise keinerlei aufregenden Abenteuer wie zum Beispiel bei H. G. Wells. Denn oben Genanntes ist auch schon alles an Fiktion und ballt sich ganz am Anfang der Gesichte, wenn wir zur Fiktion nicht dazu zählen wollen, dass sich Kepler im Folgenden des langen und des breiten darüber auslässt, wie denn nun Sonne und Volva von den Mondbewohnern gesehen werden können, Sonnen- und Volvafinsternisse inklusive. (Volva, nebenbei, hat nichts mit der Vulva zu tun; Kepler leitet sein Kunstwort ab vom lateinischen ‚volvere“ = drehen; Volva ist also ‚die sich Drehende‘ – sprich: die Erde vom Mond aus gesehen.)
Die Erzählung ist auch recht kurz, rund 20 Seiten in meiner Ausgabe (s.u.). Ihr folgen rund 75 Seiten Noten zum Traum, also Anmerkungen, ebenfalls von Kepler, aber später hinzugefügt. Noch später hinzugefügt, ebenfalls von Kepler, ein Geographischer Anhang oder, wenn du lieber willst, Mondbeschreibung – nochmals rund 20 Seiten. In beiden Anhängen präzisiert Kepler vor allem die Astronomie, Physik und Mathematik, die hinter seiner Mondbeschreibung steckt.
Wir befinden uns im Moment der Veröffentlichung im Jahr 1634. In der Astronomie tobt gerade der Kampf zwischen Wissenschaft und Kirche. Es geht um nichts geringeres als die Deutungshoheit über die Bewegungen der Sonne und der Planeten. Die Kirche – und mit ihr natürlich auch viele Wissenschaftler – beharrt noch auf dem aristotelisch-ptolemäischen Weltbild, das die Erde in die Mitte diverser Himmelssphären setzt, in denen die übrigen Himmelskörper um diese kreisen. Tycho Brahe, dessen Nachfolger als kaiserlicher Hofastronom (und -astrologe!) Kepler später werden sollte, hatte bereits ein bisschen an der Stellung der Erdkugel als Mittelpunkt des Universums gerüttelt, indem er die Planeten nunmahr um die Sonne kreisen ließ, diese allerdings noch im alten Stil um die Erde. Kepler war zunächst (und wohl auch noch beim Abfassen des ersten Teils unseres Textes) ein Anhänger der Theorie seines Lehrers, weitere Beobachtungen und Berechnungen ließen ihn aber davon abkommen und die Sonne mit ihren Planeten (von denen die Erde nun nur ein weiterer war) ins Zentrum rücken. Zusammen mit der Berechnung der elliptischen Bahnen der Planeten war das der große Durchbruch Keplers in der Astronomie. Den versuchte er, auch mit seinem Traum bwz. seinen Erläuterungen dazu zu propagieren.
Der Text geriet allerdings rasch in Vergessenheit. In der vor mir liegenden Ausgabe findet sich noch ein Anhang von Beatrix Langner, Das Kugelspiel. Ein Leitfaden für Mondreisende. Darin fragt sich Langner, weshalb die Wissenschaft nicht schon früh auf dieses erste Beispiel einer Mondreise aufmerksam wurde. Zwar braucht Kepler als Antrieb noch einen Dämon, aber viele der heute bekannten physikalische Gesetze zum Verlassen der Erde hat er schon gekannt und angewendet. Doch mehr als spekulieren kann Langner auch nicht. Im Übrigen ist der Anhang manchmal erhellend, manchmal verwirrend. Ein bisschen mehr Ordnung hätte ihm gut getan. So muss man sich leider die vielen guten Informationen, die er enthält ein bisschen zusammen klauben und selber zusammensetzen.
Unter dem Strich möchte ich aber Keplers Traum ebenso wie Langners angehängtes Kugelspiel nicht nur den an der Geschichte der (deutschen) Science Fiction Interessierten empfehlen sondern ebenso welchen, die die Geschichte der Astronomie in der frühen Neuzeit interessiert.
Johannes Kepler: Der Traum, oder: Mond-Astronomie. Aus dem Lateinischen von Hans Bungarten, herausgegeben und mit einem Leitfaden für Mondreisende von Beatrix Langner. Berlin: Mathes & Seitz, 2011.