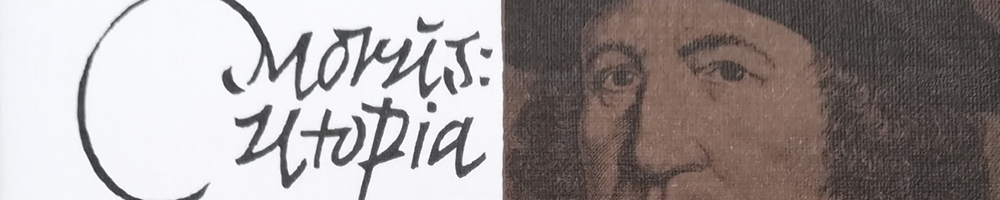Ich habe Thomas Morus‘ Utopia ja heuer nicht zum ersten Mal gelesen. Aber ich habe es noch nie gelesen, ohne dass mich jedes Mal ein größeres oder kleineres Unbehagen ergriffen hätte.
Dabei ist die literarische Form von Utopia nicht ungelungen. Wir haben zu Beginn, in einer Rahmenerzählung, einen Ich-Erzähler, der den Namen des Autors trägt, und der tut, was der Autor in der Realität tatsächlich getan hat, er weilt nämlich auf diplomatischer Mission für sein Königreich in den Niederlanden. Die Gespräche pausieren für eine Zeit, weil die Gegenseite neue Instruktionen von zu Hause anfordern muss oder will. Diese Pause benutzt das erzählende Ich, um sich mit seinen humanistischen Freunden in den Niederlanden zu treffen – auch das hat sich im realen Leben des realen Thomas Morus so ereignet. Nachdem auf diese Weise also eine Realität oder Wahrheit für die folgende Geschichte gesichert zu sein scheint, gleitet der Autor nunmehr elegant in die Fiktion ab. Thomas Morus trifft in Antwerpen seinen Freund Petrus Aegidius, einen Mann von großer Zuverlässigkeit und angesehener Stellung bei seinen Mitbürgern. Das wird wohl auch in der Realität noch so gewesen sein, aber nun erfahren wir im Text, dass der Ich-Erzähler diesen Petrus Aegidius im Gespräch antrifft mit einem Fremden. Dieser, mit Namen Raphael Hythlodeus, ist offenbar auf der ganzen Welt herumgekommen, kein eigentlicher Abenteurer, sondern ein Gelehrter, der seine Gelehrsamkeit nicht nur aus Büchern holen will. Diese Figur ist reine Erfindung von Thomas Morus. Es ist diese Figur nun, die in den folgenden zwei Binnenerzählungen zu Worte kommt. Die erste Binnenerzählung ist eine beißende Kritik der englischen Art und Weise, mit Dieben umzugehen und auf diese Art und Weise noch stolz zu sein: Man hängt die Diebe nämlich gleich dutzendweise auf, statt, wie es Raphaels Vorschlag wäre, dafür zu sorgen, dass die ökonomischen Verhältnisse dieser Leute durch verschiedene Gesellschaftsreformen dahin gebracht würden, dass sie nicht Hunger zu leiden hätten, denn – davon ist Raphael überzeugt – es ist dieser Hunger und die Aussichtslosigkeit, einen anständigen Job zu erhalten, die diese Männer dazu verführen, ihr Geld auf verbrecherische Weise zu verdienen.
Diesen Ausführungen kann man im Grunde genommen nur zustimmen. Dann aber folgt Raphaels zweite Erzählung, die nun von der irgendwo in der Ferne liegenden Insel Utopia handelt. Raphael will dort runde fünf Jahre mit ein paar Gefährten gelebt haben, nachdem er sich unterwegs von Amerigo Vespucci, auf dessen Schiff er als Gast mitreiste, getrennt hat. Und es ist hier, auf Utopia, wo mich noch bei jeder Lektüre das Unbehagen packt. Nicht, dass die utopische Gesellschaft zu schön wäre, um wahr sein zu können. Sie ist – seltsamerweise – nicht schön. Das liegt nicht einmal daran, dass auf Utopia kein Privatbesitz vorkommt. Das Land ebenso wie Bodenschätze und die Erzeugnisse der Landwirtschaft gehören allen – also dem Staat. Man könnte auch sagen, sie gehören dem Staat – also allen. Denn seit Jahrhunderten herrscht auf Utopia eine starke Identifikation des Einzelnen mit dem Ganzen – hervorgerufen durch mehr oder weniger subtile Indoktrination und Kontrolle eines jeden durch die Gruppe. Das System kennt harte, aus heutiger Sicht grausam zu nennende Strafen für Abweichler. Das geht bis hin zur Versklavung (ehemaliger) Mitbürger. Sklaven werden auch die Soldaten von Staaten, mit denen die Utopier Krieg geführt haben. Denn ja: Sie führen Krieg – wenn sie auch behaupten, dies nur zur Selbstverteidigung tun oder um befreundeten Nationen beizustehen. Sie heuern dafür primär Söldner an, nur im äußersten Notfall kämpfen sie selber. Lieber noch als zu kämpfen, üben sie sich in psychologischer Kriegsführen, aktiver Desinformation des Gegners zum Beispiel – im vollen Bewusstsein dessen, dass sie hier eigentlich völlig unethisch handeln. Aber auch bei den Utopiern heiligt der Zweck die Mittel, nicht nur bei Russen und Chinesen.
Ihre Staatsform ist gerontokratisch: Die Ältesten regieren immer kleine Gruppen von ein paar Familien; Gruppen, die ihrerseits in größere Verwaltungseinheiten zusammengefasst sind, in denen wiederum die Ältesten das Sagen haben. Mahlzeiten werden prinzipiell gemeinsam eingenommen – ausgenommen sind hier nur die Bauern auf dem Land, die zu weit auseinander wohnen, um für solches in Frage zu kommen. Jeder Utopier ist verpflichtet, zumindest einmal in seinem Leben zwei Jahre in einem solchen landwirtschaftlichen Betrieb zu verbringen. Wer will kann auch länger bleiben. Ansonsten übernehmen die (männlichen!) Kinder in der Stadt meistens den Beruf des Vaters. Etwas anderes als handwerkliche Berufe gibt es kaum, außer ein paar Gelehrten und Geistlichen. Die Töchter lernen, einen Haushalt zu führen.
Es sind mir zu viele Übel der aristokratisch-kommunistischen Lebensweise aus Platon Staat auf dieser Insel Utopia, als dass sie mir gefallen könnte. (Die Gemeinschaft der Frauen und Kinder allerdings hat Morus weislich aus Utopia weggelassen. Die Utopier kennen eine nur im äußersten Notfall trennbare Ehe katholischen Zuschnitts. Und kinderreiche Familien, die die Grundzelle der utopischen Gesellschaft vorstellen. Immer schön mit dem Pater familias an der Spitze.)
Das einzig meiner Ansicht nach halbwegs Erstrebenswerte dieser utopischen Gesellschaft ist deren Einstellung zur Religion. Zwar sind auch sie der Meinung, dass ein religionsloser, das heißt also wohl ein gottloser Mensch keine gesellschaftliche Daseinsberechtigung hat, da ein Mensch ohne Gott zwangsläufig ein Mensch ohne Moral sein müsse, dem man in gar nichts über den Weg trauen dürfte. Sie kennen unter sich sogar verschiedene Religionen, die allerdings alle dahingehend ähnlich sind, dass sie ein einzelnes höchstes Wesen anerkennen. Deshalb konnten sie auch einen für alle Utopier ‚gültigen‘ Namen dafür erfinden und in ihren Kirchen wird zwar auch tapfer jeden Sonntag vom Priester gepredigt, aber das göttliche Wesen immer nur mit dessen allgemeingültigen Namen angerufen, so dass jeder, egal, welcher Religion er im Detail anhängt, an so einem Gottesdienst teilnehmen kann, weil sich der Gläubige jeweils seine ganz spezielle Vorstellung von diesem Gott machen kann oder muss. Für seinen eigenen Glauben anders zu missionieren, als durch ein eigenes, mustergültiges Leben, ist verpönt, ja wird bestraft. (Auch ein Nikolaus von Kues hat im Grunde genommen dasselbe Modell religiöser Toleranz gepredigt.)
Leider lassen weder Raphael noch der Autor selber die Utopier in diesem relativ glücklichen Zustand. Aus welchem Grund auch immer: Raphael und seine Gefährten reden mit den Utopiern über den christlichen (katholischen) Glauben, und nun glauben die Utopier, warum auch immer, im Christentum die Vollendung des liberalen deistischen Denkens gefunden zu haben, in dem sie bis anhin lebten. Und schon wieder packt mich ein Schaudern.
Dabei haben die Europäer sogar richtig gute, nicht-christliche, europäische Literatur mitgebracht. Nämlich antike, griechische. (Schon die Lateiner hält Raphael nicht für gut genug, um auf eine Reise um die Welt mitgenommen zu werden!) In Raphaels Bücherkiste finden sich Bücher von Platon, Aristoteles, Theophrast, Plutarch, Anakreon, Aristophanes, Homer, Euripides, Sophokles (in des Aldus Pius Manutius‘ schönen Lettern!), Galen, Hippokrates, Thukydides, Herodot; und sogar der Spötter Lukian darf nicht fehlen. (Die Utopier, nebenbei, kannten den Buchdruck noch nicht, obwohl sie zum Beispiel in der Medizin auf dem gleichen Stand zu sein scheinen wie die Europäer – was im 16. Jahrhundert allerdings noch nicht viel heißt. Sie sind aber sehr schnell, wenn es darum geht, etwas Neues zu lernen, und schon bei seiner Abfahrt noch fünf Jahren Aufenthalt kann Raphael die Bücher nicht mehr zählen, die unterdessen auf Utopia zirkulieren.)
Indoktrination, Kontrolle und bedingungslose Subordination sind in Utopia an der Tagesordnung. Nur Epochen, die an solches gewöhnt sind, können ein Leben wie das der Utopier als erstrebenswert erachten. Immerhin kennen die Inselbewohner keine Ausbeutung der ganz Armen durch die ganz Reichen (wie es von Raphael-Morus im ersten Teil des Buchs am Beispiel der englischen Diebe angeprangert wird!). Sie kennen auch keine Aristokratie, wo nur der Zufall einer Geburt in der richtigen oder falschen Familie über das Schicksal eines Einzelnen so tiefgreifend bestimmen kann. Sie kennen keine Bevorzugung eines Individuums, außer der durch das Alter.
Mich, Kind des 20. Jahrhunderts, hat, wie gesagt, noch bei jeder Lektüre von Utopia ein Unbehagen ergriffen.
Gelesen in der Version folgenden Taschenbuchs:
Der utopische Staat. Morus • Utopia / Campanella • Sonnenstaat / Bacon • Neu-Atlantis. Übersetzt und mit einem Essay ‹Zum Verständnis der Werke›, Bibliographie und Kommentar herausgegeben von Klaus J. Heinisch. Reinbek: Rowohlt, 1996. (= Rowohlts Klassiker der Literatur und der Wissenschaft / Philosophie des Humanismus und der Renaissance 3) [Eine dieser Reihen, die im 20. Jahrhundert auch grosse Publikumsverlage aufbauten, weil sie sich einem gewissen Bildungsauftrag verpflichtet fühlten. Im 21. Jahrhundert wird auf diesen Auftrag, einen daraus resultierenden Ruhm und guten Ruf nunmehr fröhlich gepfiffen. Wo die Gewinnausschüttung für die Aktionäre wichtig ist, werden alle diese Reihen, da wirtschaftlich uninteressant, ja kontraproduktiv, eingestellt.]