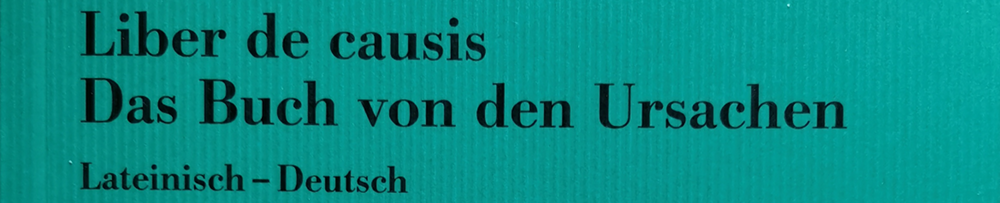Gerhard von Cremona übersetzte dieses Werk 1176 (oder etwas später) aus dem Arabischen ins Lateinische. Es trug zunächst den Titel Liber de expositione bonitatis purae („Buch zur Erklärung der reinen Güte“), der den neuplatonischen Hintergrund des Werks besser trifft als Liber de causis, ein Titel, der sich erst im 13. Jahrhundert durchsetzte. Doch zunächst hielt man in der europäischen Frühscholastik noch Aristoteles für den Autor des Werks und vermutete darin eine Ergänzung von dessen Metaphysik, die man als unvollständig betrachtete. Allerdings ist es, nachdem 1268 auch Proklos übersetzt worden war, Thomas von Aquin aufgefallen, dass der Liber de causis eine Art Zusammenfassung oder Kommentar zu dessen Grundlagen der Theologie darstellte. Der Liber de causis folgt dem Neuplatoniker Proklos zunächst ziemlich genau, weicht dann aber bei einem wesentlichen Punkt von ihm ab – dort nämlich, wo er die einzige letzte Ursache, den ersten Grund der Wirklichkeit, mit dem reinen Sein identifiziert. Hier kommt offenbar plotinisches Gedankengut ins Spiel – Proklos sah den ersten Grund außerhalb bzw. oberhalb des Seienden. Auch, dass dieser erste Grund mit der Güte identifiziert wird, weist auf auf Platonisches zurück – sogar direkt auf den Meister, der im Staat genau diese Güte oder Gutheit als oberste Idee propagiert hatte.
Anders als die mittelalterlichen Denker sind die heutigen Forscher der Meinung, dass es nie einen griechischen Originaltext des Liber de causis gegeben habe, sondern es sich tatsächlich ’nur‘ um eine Art Kommentar eines uns unbekannten arabischen Denkers zu Proklos handelt.
Dennoch wurde das Buch weiter in der scholastischen Ausbildung verwendet. Seine auf Plotin zurückgreifende Emanationslehre passte gut zum christlichen Gedankengut mit dem einzigen Schöpfer, der zwar alles geschaffen hat, aber nicht jedes kleine Fitzelchen selber besorgt hat. Es gab christliche Interpreten im Mittelalter, die in den Intelligenzen, die die erste Ursache geschaffen hat, eine Hierarchie von Engeln sah – so, dass Gott eigentlich nur die obersten Engel geschaffen hätte, diese dann die nächsttieferen und so weiter. Das war wohl nicht der Gedanke des unbekannten Arabers, aber er war ziemlich sicher ein gläubiger Muslim und das Buch auch zur Verteidigung bzw. Erklärung des einzigen Gottes und seiner Schöpfung im Monotheismus gedacht. Somit war es nur folgerichtig, wenn die Scholastik ebenfalls darauf zurückgriff. Ja, während der Text in der arabischen Philosophie offenbar eher ein Nischendasein führte, war er eine Zeitlang in der Scholastik sehr präsent. Heute stehen deshalb den überlieferten drei arabischen Handschriften (davon keine einzige aus genau der Überlieferungstradition der Handschrift, die Gerhard von Cremona übersetzt hatte) – den drei arabischen Handschriften also stehen weit über 100 lateinische Kopien gegenüber, die man heute noch findet.
Zu den bekanntesten Kommentatoren bzw. Rezipienten des Liber de causis gehörten neben Thomas von Aquin dessen großer Vorgänger Albertus Magnus; auch Roger Bacon verfasste einen Kommentar zum Kommentar. Mit dem Aufkommen des Nominalismus verlor der Liber de causis an Relevanz – heute ist er wohl am ehesten noch präsent, weil wir in verschiedenen Werken Dantes Spuren von ihm finden. Und natürlich in den Werken von Meister Eckhart, da die Transzendenz- und Emanationslehre des Liber zur Untermauerung von dessen eigener Theologie bestens geeignet war. Von Meister Eckhart wiederum gibt es Traditionsfäden bis zu Hegel …
Den Inhalt habe ich oben ja schon skizziert. In 31 (oder in manchen Handschriften 32) Kapiteln wird jeweils eine These präsentiert, die im Folgenden des Kapitels dann expliziert wird. Der wissenschaftliche Weg der mittelalterlichen Denker ist also genau der umgekehrte, wie wir ihn heute verfolgen: Da ist zunächst die These, die dann mit logischen Mitteln bewiesen und so zum Faktum wird. Meister Hegel sollte dies dankbar in seine Philosophie aufnehmen.
Wer also ein bisschen Hegel treiben will, ohne Hegel lesen zu müssen, Dialektik (im Hegel’schen Sinn, nicht im antiken platonischen!) treiben will, ohne gleich in Hegel einzutauchen, kann das mit dem Liber de causis tun. Die von mir benutzte zweisprachige Ausgabe (s. u.) ist dabei durchaus von Nutzen, auch wenn der philologische Teil für meinen Geschmack zu sehr betont wird.
[Anonymus]: Liber de causis / Das Buch von den Ursachen. Mit einer Einleitung von Rolf Schönberger. Übersetzung, Glossar, Anmerkungen und Verzeichnisse von Andreas Schönfeld. Lateinisch – deutsch. Hamburg: Felix Meiner, 2003. (= Philosophische Bibliothek 553)