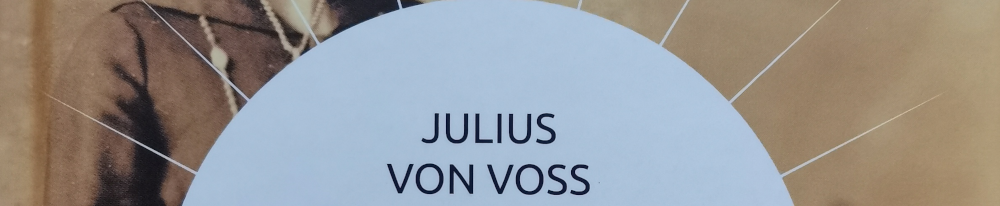Ini heißt die Geliebte von Guido, dem Helden dieses Buchs. Und wenn ich hier „Held“ schreibe, so meine ich „Held“. Guido vereinigt in sich alle Tugenden eines hehren Kriegers, Liebenden und Herrschers, wie sie sich sonst nur der trivialromantische Ritterroman des deutschen Vielschreibers Fouqué in einer Person versammelt imaginieren konnte – Romane, die zur selben Zeit geschrieben worden sind wie Ini, also um 1810. Derselbe Ausbund an Tugenden ist natürlich auch Ini, auch sie stellt ein Muster dar von körperlicher, geistiger und seelischer Vollkommenheit. Genauer gesagt, wollen und sollen sich beide im Lauf der Geschichte zur ganzen Vollkommenheit noch bilden. Der Unterschied von Voß’ Roman zum Ritterroman Fouqués liegt vor allem in der gewählten Epoche. Anstatt Jahrhunderte in die Vergangenheit verlegt Julius von Voß seine Erzählung Jahrhunderte in die Zukunft. Es handelt sich bei Ini nämlich gemäß Untertitel um Ein[en] Roman aus dem ein und zwanzigsten Jahrhundert.
Das führt zur nächsten Frage, die von den beiden Herausgebern meiner Ausgabe in Vor- und Nachwort respektive unterschiedlich beantwortet wird: Handelt es sich bei Ini um einen echten Science Fiction-Roman oder nur um eine Art Vorläufer? Ist er echte Science Fiction, dann wäre er der erste Science Fiction-Roman der Weltliteratur, wenn wir davon ausgehen, dass Brian Aldiss, der den Deutschen nicht kannte, in seiner Geschichte der Science Fiction-Literatur (Der Millionen-Jahre-Traum) ansonsten Recht gehabt hätte damit, Frankenstein von Mary Shelley von 1818 (also acht Jahre nach von Voß) diesen Titel zu verleihen. Solche Diskussionen sind meist müßig (sie ist es auch hier), weil alles darauf ankommt, wie ich „Science Fiction“ definiere. Beide Romane sind – von einem rein literarischen Standpunkt betrachtet – keine Meisterstücke. Sie weisen Längen auf und mischen in nur halb durch gedachter Art verschiedene Formen und Genres. Bei Frankenstein ist es nur der Anfangs- und Ausgangspunkt der Geschichte, den man guten Gewissens als „Science Fiction“ bezeichnen kann. Nachdem Frankenstein ein neues Lebewesen erschaffen hat, indem er ihm den elektrischen Lebensfunken eingehaucht hat, verlässt der Roman dieses Gebiet und wechselt über in ein Beziehungsdrama in krudester Sturm und Drang-Manier. Von Voß seinerseits – anders als sein Vorbild Mercier mit L’An Deux Mille Quatre Cent Quarante, auf das er sich einmal bezieht, wenn der Erzähler aus der Geschichte heraustritt und davon spricht, dass er hier seine Träumereien zu Papier bringe – von Voß also ist sich zwar dessen von Anfang an bewusst, dass er nicht einen Roman im 21. Jahrhundert spielen lassen kann, ohne dass in der Politik und Religion, den Wissenschaften und den Künsten einige Dinge sich anders darstellen, als noch im Jahr 1810. Im Großen und Ganzen trägt sein 21. Jahrhundert politisch-utopische Züge. Zumindest im unterdessen geeinten Europa lebt niemand mehr in Armut; die (bildenden) Künste sind auf einem Idealstand angekommen, der sogar den der antiken griechischen Klassik übertrifft. Auch die Technik hat sich weiterentwickelt. Die Darstellung dieser Entwicklungen ist zwar nun die Achillesferse unseres Autors, da er offenbar davon wenig versteht. Man reist zum Beispiel mit Ballons, an denen ganze (heizbare!) Häuser befestigt sind. Dies ist möglich, weil man das Azot so verfeinern konnte, dass es leichter wurde. Nun ist „Azot“ ein alter Name für Stickstoff und wie man sich das vorstellen muss, wird nicht ganz klar. Wahrscheinlich hat von Voß hier eine Reminiszenz an den Luftschiffer Giannozzo einen Streich gespielt, wo Jean Paul davon spricht, dass der Luftschiffer seine Barke mit azotischer Luft fülle. Vorwärts bewegt und gesteuert werden von Voß’ Ballons von speziell dafür gezüchteten und abgerichteten Adlern. So reist man durch die Lüfte, und ähnlich wie im 19. Jahrhundert die Postkutsche kennen auch diese Ballons Strecken, auf denen sie nach Fahrplan verkehren, inklusive Relaisstationen, bei denen die Reisenden sich verpflegen können und man die Adler wechselt. Die meisten technischen Verbesserungen aber, die von Voß schildert (und dies wahrlich „con amore“!), betreffen das Kriegs- und Waffenwesen. Denn bei aller Utopie liegt das vereinigte Europa doch im ständigen Krieg mit dem benachbarten asiatischen Reich und auch mit dem (in weißer Hand!) vereinigten Afrika. Von Voß schwelgt richtiggehend in den Schilderungen sowohl des technischen Fortschritts im Waffenwesen wie von Kriegshandlungen. (Und natürlich ist Guido nicht nur ein Ausbund an Stärke und Tapferkeit – er kann auch als knapp 20-Jähriger schon substanzielle Verbesserungen an allen Waffen und Taktiken vorbringen.)
Mit zunehmendem Fortschreiten des Romans wird klar, dass von Voß sich vor allem auf die politische Seite seiner Utopie konzentriert. Was er propagiert (das zeigt sich unter anderem daran, dass in Berlin als einziges Standbild eines Herrschers aus früheren Zeiten das von Friedrich II. von Preußen stehen geblieben ist), ist tatsächlich ein geeintes Europa unter einem absolutistischen, aber aufgeklärten Herrscher, dem Kaiser, dem seinerseits verschiedene Regional-Herrscher (Könige) unterstellt sind. So, wie beim Postballon-Wesen die Postkutsche seiner Gegenwart, spielt ihm auch hier sehr offensichtlich die Gegenwart in Form der napoléonischen Bestrebungen in die Fiktion hinein.
Das Ganze ist in einer Sprache geschrieben, die gehoben sein will, tatsächlich aber eine etwas ridiküle Mischung aus Goethe’schem Kurialstil und dem sprachlichen Schwung von Schillers Gedankenlyrik darstellt.
Alles in allem trotz aller sprachlicher und inhaltlicher Seltsamkeiten (nein: genau deswegen) eine vergnügliche Lektüre – allerdings nicht in dem Sinne, wie es der Autor geplant hatte. Zum Schluss lassen sich gar – seltsam genug angesichts des übrigen Romans – eindeutig pazifistische Tendenzen ausmachen, wenn die Versöhnung mindestens von Europa und Afrika mit Unterstellung unter einen gemeinsamen Herrscher, nämlich Guido, gefeiert wird.
Julius von Voß: Ini. Roman aus dem einundzwanzigsten Jahrhundert. Berlin: Hirnkost KG, 2022.
[Es handelt sich hier um einen kompletten und mit Liebe gestalteten Neusatz des Textes. Fester Einband, Fadenheftung und Lesebändchen vervollständigen den recht gediegenen Eindruck des Buchs. Man lasse sich auch nicht von dem teilweise in gebrochener Schriftart gesetzten Titel irritieren. Diese Schriftart wird heute häufig von brauner Seite her missbraucht (in absoluter historischer Unkenntnis, nebenbei); hier haben wir aber nichts Derartiges vor uns. Die lila statt schwarz gedruckten Lettern sind allerdings gewöhnungsbedürftig und wären wohl nicht nötig gewesen. Im Übrigen, für Interessierte: Das Buch ist Teil einer neuen Reihe Utopien in der Science Fiction oder Wiederentdeckte Schätze der deutschsprachigen Science Fiction, die 2022 vom Hirnkost-Verlag begonnen wurde.]