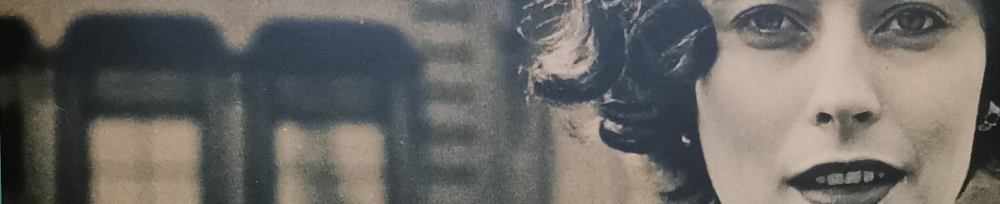Lessons in Chemistry (so der Originaltitel) ist Bonnie Garmus’ erster (und, so weit ich sehe, bisher auch einziger) Roman. Er wurde, nachdem er 2022 in den USA erschienen war, sofort zu einem Weltbestseller. Das ist umso erstaunlicher, als Garmus zu diesem Zeitpunkt bereits über 60 Jahre alt war – wie zum Beispiel auch Fontane also eine Spät-Angekommene, wie Fontane aber nicht eine Spät-Berufene. Sie wollte schon immer einen Roman schreiben und hatte (deswegen?) in ihrem ganzen Leben schon immer mit Texten zu tun – ebenfalls wie Fontane, nebenbei gesagt.
Nun ist es so eine Sache mit Weltbestsellern. Vor allem wenn sie, wie dieser hier, von meinen beiden Lieblings-Literaturkritiker:innen-Darsteller:innen über den grünen Klee gelobt werden. So stellt sich mir die Frage: Ist dieser Roman zu Recht so schnell so berühmt geworden? Die Antwort ist, wie nicht anders zu erwarten: Ja, aber …
Das Ganze hat nämlich etwas Janusköpfiges. Um die wirklich gut gelungenen Dinge vorweg zu nehmen: Die Darstellung der Hindernisse, die Frauen (übrigens bis heute – auch wenn der Roman Ende der 1950er, Anfang 1960er spielt) von Männern in den Weg gelegt werden, wenn sie versuchen, in eine ihrer so genannten Bastionen einzudringen (wie im vorliegenden Fall die der Naturwissenschaft, genauer gesagt, der Chemie), ist nachgerade brutal offen. Von Einschüchterungsversuchen, Demütigungen, ungerechtfertigten Entlassungen bis hin zu Vergewaltigungen kommt in diesem Buch alles vor. Ich weiß selber von Frauen, die – etwas später als Elizabeth Zott, Garmus’ Protagonistin – in solche beruflichen Männerbastionen eingedrungen sind, dass Garmus hier nur wiedergibt, was de facto so abgelaufen ist oder so hätte ablaufen können. Und es soll mir niemand sagen, dass diese Zeiten heute glücklicherweise vorbei sind. Bis heute werden die Nobelpreise in den Naturwissenschaften mit Vorliebe an Männer vergeben …
Das ist also der Kern des Buchs und vielleicht auch der Kern von dessen Erfolg – etwas, das mir , wie gesagt, auch sehr gut gefallen hat. Ebenfalls gut gelungen ist der Autorin ihre Protagonistin – eine Frau, die zunächst schicksalsergeben alles hinnimmt, dann aber immer härter und kompromissloser wird. Sie ist voll eines zynischen Humors, der sie, paradoxerweise, zu einer sympathischen Gestalt macht, deren Schicksal man gern, ja gebannt, folgt. Sie ist Wissenschaftlerin mit Leib und Seele – das geht so weit, dass sie zu Hause ihre Küche ausgebaut und, als Heimwerkerin, ein kleines Labor statt ihrer installiert hat, in dem sie forscht und nebenbei auch kocht. Als sie – über Umwege, die ich hier nicht verrate – zu einer bekannten Fernsehköchen wird, ist das keineswegs Verrat an ihren wissenschaftlichen Ambitionen. Sie betrachtet das Kochen als eine Abfolge chemisch-physikalischer Prozesse und schildert sie auch dem Publikum so. Was, nebenbei gesagt, dann auch ihre Beliebtheit ausmacht, denn für einmal fühlen sich die doch vorwiegend weiblichen Zuschauerinnen der Kochshow Ernst genommen. Daneben glänzt ein Hund namens Halbsieben in einer Nebenrolle, den ich zumindest auch sehr mochte.
Der Kern des Romans ist also gut. An der Schale allerdings ist nicht alles so gelungen, wie ich finde. Wenn Elizabeth Zott zum Beispiel für Gleichberechtigung von schwulen und queeren Personen plädiert, klingen ihre Formulierungen, schon im verwendeten Wortschatz, zu sehr nach den 2020ern. So, wie sie in diesem Moment, hätte zu Beginn der 1960er niemand geredet. Schließlich der Schluss des Romans: Nachdem wir den ganzen Roman hindurch die Protagonistin als eine Stehauf-Frau erlebt haben, die sich immer wieder aufrappelt, aber auch immer wieder aufs Dach kriegt, nimmt die Geschichte im letzten Viertel des Romans eine Wendung ins Märchenhafte. Es tauchen neue Figuren auf, die Zott zu ihrem Recht beim ehemaligen Arbeitgeber verhelfen und dazu, dass sie endlich als Chemikerin ihre Forschung weitertreiben kann. Das ist zwar Balsam auf die geschundenen Seelen der Protagonistin wie der Lesenden, aber ein Scheitern der Protagonistin wäre sehr viel realistischer gewesen. Oder, sagen wir: ein Leben auf einem Nebengeleise.
Und noch eine kleine Randbemerkung: Es gibt einen Moment in ihrer Kochshow, da wird Zott gefragt, welches Gebet sie vor dem Essen jeweils spreche. Diese Frage ist so US-amerikanisch, dass ich sogar glaube, dass sie hätte gestellt werden können. Zott, in ihrer geradlinigen und kompromisslosen Art, gibt offen zu, gar nicht zu beten, weil sie Atheistin ist. Dass diese Aussage zu jener Reaktion führt, die wir heute in den Social Media als Shit-Storm bezeichnen, ist nachvollziehbar. Dass dieser Shit-Storm sehr rasch abebbt, ebenfalls – es gab damals jene (semi-)professionellen Anheizer noch nicht, die so etwas heute in den Social Media weiter anfachen und pushen. Dass dennoch eine Frau eine Bombe in die Show schmuggelt … je nun. Dass aber Elizabeth Zott später ihre Aussage (zugegeben: nicht in der Öffentlichkeit!) dahin gehend korrigiert, eigentlich sei sie ja Humanistin – dieses Seine-Aussage-dann-doch-noch-Abschwächen bzw. -Ändern ist ebenfalls typisch US-amerikanisch. Nur gebe ich in diesem Fall nicht Zott die Schuld sondern ihrer Schöpferin Garmus. Dass es auch philosophisch-theologischer Unsinn ist, was sie Zott da sagen lässt, weil es auch gläubige Humanist:innen gibt, was Zott ja nicht sein soll, ist ein Faux-Pas, der einer Figur von ihrer geistigen Statur nicht zuzutrauen ist. (Oder vielleicht doch – nicht jede:r Naturwissenschaftler:in und nicht jede:r US-Amerikaner:in kennt sich in terminologischen Fragen der Geistesgeschichte aus.)
Zum Schluss noch etwas, das ich persönlich bedauere: Zwar erfährt man, dass Elizabeth Zott eine Kochshow leitet, in der sie das Kochen von Gerichten demonstriert, wie wenn es sich dabei um chemische Experimente handeln würde, aber die wenigen Szenen, die Bonnie Garmus schildert, bleiben – sowohl chemisch wie kulinarisch – dann doch sehr an der Oberfläche der Materie. Da hatte ich mehr erwartet.
Ergo: Mit kleinen Abstrichen lesenswert. Danke für den Tipp!
Bonnie Garmus: Eine Frage der Chemie. Übersetzung aus dem Englischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann. München: Piper, 17[!]2023