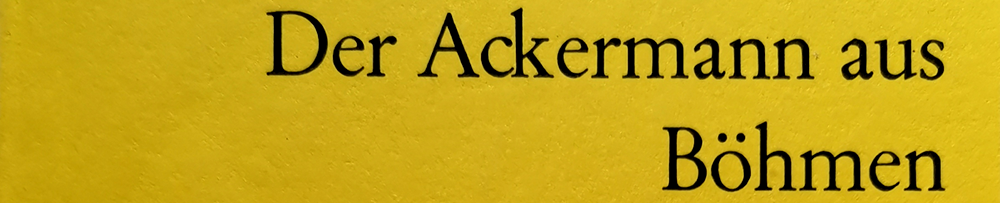Sprachlich noch mittelhochdeutsch, also Mittelalter, inhaltlich aber schon voraus, auf den Humanismus, verweisend: Der Ackermann aus Böhmen aus dem Jahr 1401. Über den Autor wissen wir wenig, und außer dem Ackermann wird heute auch nichts mehr von ihm gelesen. Johannes war wohl tatsächlich sein Vorname; Tepl aber ist der Name einer böhmischen Stadt, in der er wohl längere Zeit gelebt hat. Eine der biografischen Spuren, die man lange auf sicher zu haben glaubte, war jene, dass der Ackermann mit der Klage über den Tod seiner Gattin realiter auf dem Tod einer ersten, jungen Gattin des Johannes von Tepl beruhte. Heute wird auch das angezweifelt.
Beim Ackermann handelt es sich um ein Streitgespräch zwischen einem menschlichen Protagonisten (eben dem Ackermann aus Böhmen und dem Tod (der diesem Ackermann soeben seine Frau geraubt hatte). Der Ackermann setzt ein, indem er Zeter und Mordio schreit. Was wir heute nur noch im übertragenen Sinn verstehen, war im Mittelalter noch ein unumgängliches juristisches Manöver bedeutete, die tatsächliche und rechtliche Verfolgung eines in flagranti ertappten Verbrechers in Gang zu setzen. Wir wohnen also einer Gerichtsverhandlung bei. Dem heutigen Leser wird das erst klar, wenn ganz zum Schluss Gott den Fall zwischen dem Ackermann und dem Tod entscheidet. (Oder mindestens tut als ob – indem er Gott eben keine echte Entscheidung treffen lässt, tirtt Johannes von Tepl aus dem Kreis mittelalterlichen Denkens.)
Der Ackermann ist der Kläger, der Tod der Angeklagte. Der Ackermann, nebenbei, ist nicht, wie das die aktuelle Version von Wikipedia zu Johannes von Tepl behauptet, ein Bauer – dem würde sowohl des juristische wie das rhetorische Rüstzeug fehlen, über das der Ackermann hier verfügt. Der Ackermann scheint tatsächlich den gleichen oder einen ähnlichen Beruf auszuüben, wie Johannes von Tepl: Schreiber und / oder Notar. Folgendermaßen stellt er sich nämlich vor:
Ich bins genant ein ackerman, von vogelwat ist mein pflug, vnd wohne im Behemer lande.
Beginn des III. capitels
(wat bedeutet „Kleidung“ – er hat also seinen Pflug von der Kleidung eines Vogels (wie wir heute sagen würden, von dessen „Federkleid“). Vogelfedern, vor allem Gänsefedern, aber wurden damals zum Schreiben verwendet.)
Im Folgenden wird der Ackermann mit allen (juristischen und) rhetorischen Kniffen und Waffen auffahren, die im Spätmittelalter als poetisch galten. Wir finden hier viel von der Poetologie der Minnesänger wieder. Der Tod auf seiner Seite geht auf des Ackermanns Argumente gar nicht erst ein, sondern betont nur immer wieder kalt, ja zynisch, die natürliche Notwendigkeit seines Jobs. Stück um Stück knickt der Ackermann ein – aus der Anklage des Todes wird eine Bitte an ihn, ihm dabei zu helfen, den Tod seiner Frau zu verarbeiten.
Zum Schluss entscheidet Gott als der Richter, dass der Ackermann zwar die Ehre habe, der Tod aber den Sieg davontrage. Will sagen: Sein Auflehnen gegen die Notwendigkeit des Sterbens ehrt den Ackermann als Menschen – der Tod wird aber weiterhin wirken. Eine weitere Rechtfertigung für das Wirken des Todes aber gibt auch Gott nicht. Ich müsste hier nachlesen, wie weit Elias Canetti in seinem Schreiben gegen den Tod den Ackermann rezipiert hat. Es klingt sehr nach Canetti, was auch daran liegen kann, dass mit Johannes von Tepl zum ersten Mal in der Geschichte der deutschen Literatur die Rechtfertigung des Todes nicht mehr in theologischen Kategorien gesucht wurde, sondern als grausame und beklagenswerte Naturnotwendigkeit begriffen wurde, gegen die sich aufzulehnen, keineswegs verachtenswert war – im Gegenteil. Hierin verlässt Johannes von Tepl das mittelalterliche, religiös-theologische motivierte Denken ebenso wie im Umstand, dass der Ackermann offenbar eine Heirat aus Liebe eingegangen ist – in einer Zeit, in der in allen sozialen Schichten Heiraten viel mehr dem Eingehen einer Geschäftsbeziehung glich, oder (vor allem aus der damals dominierenden Sicht des Mannes) dem Erwerb einer billigen Arbeitskraft, die dann auch gleich noch Nachfolger in der Führung der Firma produzieren konnte. Mit diesem Konzept weist Johannes von Tepl im Grunde genommen sogar noch weiter voraus als in den vor der Tür stehenden Humanismus – das Konzept einer Liebesheirat wird erst mit der Romantik in breiteren Kreisen akzeptiert werden.
Was aber bleibt dem Menschen, bleibt dem Ackermann im Angesicht des Todes seiner Liebsten? Es ist, im Rückgriff auf Aristoteles und vor allem Seneca, nur das stoische Ideal der Apatheia. (Dass der Konflikt zwischen Apatheia und Liebe ungelöst bleibt, übergeht Johannes von Tepl in diesem Moment. Aber bei der Lösungsfindung ist der Ackermann schon weit vom ersten heftigen Aufwallen seines Schmerzes entfernt.)
Ein aus der Zeit Gefallener also, der zudem mit seiner Schilderung von Schmerz und Trauer beim Tod eines lieben Menschen bis heute zu packen versteht.
Johannes von Tepl: Der Ackermann aus Böhmen. Originaler Text und Übertragung. Übertragung, Nachwort und Anmerkungen von Franz Genzmer. Stuttgart: Reclam, 1963. (= RUB 7666)