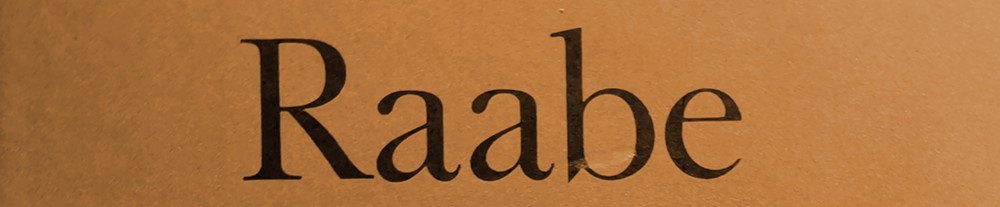Auf Twitter habe ich in den letzten Wochen diverse Male davon geschwärmt, dass Wilhelm Raabe einer der besten Romanciers ist, die es überhaupt je gegeben hat. Dabei ist mir dann aufgefallen, dass er hier auf dieser Seite noch gar nie mit einem eigenen Werk vorgestellt worden ist. Das will ich heute ändern. Und da ich auf Twitter auch immer wieder mal davon geredet habe, dass Stopfkuchen der beste Roman Raabes ist, fiel meine Wahl für die (hoffentlich!) Premiere Raabes hier auf eben diesen Roman. (Auch Raabe war übrigens der Meinung, mit Stopfkuchen sein bestes Werk geschrieben zu haben.)
Die hohe Qualität dieses Romans ist in vielen verschiedenen Kategorien zu suchen – ich gebe hier nur ein paar Beispiele und fange an mit der Komposition. Die Geschichte findet – grob gesagt – auf drei Ebenen statt. Da ist die Rahmenerzählung, in der der Ich-Erzähler beschreibt, wie er sich im Rauchzimmer des Dampfers von Deutschland nach Südafrika verschanzt und den vorliegenden Bericht schreibt. Eduard (so heißt der Ich-Erzähler, und er ist sich der Namensgleichheit mit Goethes Protagonisten ebenso bewusst wie sein Freund Heinrich Schaumann, genannt „Stopfkuchen“) – Eduard also ein Deutscher, der seit langem in Südafrika heimisch und wohlhabend geworden ist. Nun befindet er sich auf der Fahrt zurück zu Frau und Kindern, nachdem er seine alte Heimat zum ersten Mal seit Jahren wieder besucht hat. Dieser Besuch bildet dann die erste Binnenerzählung, die ihrerseits zu einer Rahmenerzählung werden wird. Nachdem Eduard zunächst sehr im Allgemeinen geblieben ist, was den Verlust alter Freunde durch Tod oder Abreise betrifft, erfährt er zufällig davon, dass gerade eben der Landbriefträger Störzer gestorben ist. Mit diesem nun hat sich der Junge Eduard stundenlang unter Hecken herumgetrieben und in François Levaillants Erzählung von dessen Afrika-Reise geschmökert. Zu spät! Doch, was larmoyante Klage hätte werden können, führt Eduard stattdessen zuerst in Gedanken, dann in der Realität, zu einem andern Jugendfreund – dem mit ihm gleichaltrigen Heinrich Schaumann. Der ist noch am Leben, bewohnt nun die – in Eduards Jugend wegen des dortigen Bauern Quakatz berüchtigte – so genannte Rote Schanze. Von dort wurde im Siebenjährigen Krieg die Stadt (die mit Wolfenbüttel zu identifizieren ist, auch wenn sie im Roman nie einen Namen erhält) von den Feinden mit Kanonen beschossen. Quakatz ist ein alter verbitterter Mann, dem die Stadt-Fama nachsagt, er hätte vor Jahren den Viehhändler Kienbaum erschlagen. Deshalb wurde er ausgegrenzt, deshalb ist er wütend und verbittert. Nur Stopfkuchen wird es im Lauf der Zeit gelingen, sein Vertrauen und das Herz seiner Tochter zu gewinnen. Diese Geschichte nun, wie Stopfkuchen zum neuen Bauern auf der Roten Schanze wird, bildet die zweite Binnenerzählung, mit Stopfkuchen als Ich-Erzähler. Die drei Ebenen sind nun aber nicht fein säuberlich getrennt. Sie gehen vielmehr immer wieder in einander über – wie es halt auch Erinnerung und Gedächtnis, zunächst des ersten Ich-Erzählers Eduard, dann des zweiten Stopfkuchen, gerade so anliefern. Dennoch verliert das Publikum nie den Überblick, der rote Faden der Erzählung ist allemal gut ersichtlich.
So viel, andeutungsweise, zur Konstruktion. Es gibt auch andere, mikrokompositorische Ebenen. Da ist der Umstand, dass Eduard mit seinem Freund „Geografie“ betreibt, Landkarten studiert und sich später als Schiffsarzt auf(!)den Weltmeeren herumtreibt. Stopfkuchen hingegen, arrivierter Bauer auf der Roten Schanze, hat sich als Hobby die Paläontologie ausgesucht und gräbt auf seiner Schanze nach alten Knochen. Eduard ist der, der sein Leben lang an der Oberfläche der Dinge geblieben ist, nie gemerkt hat, wie sehr sein Freund Schaumann darunter litt, dass ihn alle links liegen ließen, weil er schon als Junge zu schwache Füße für einen zu dicken Körper besaß; Eduard ist der, der nie gemerkt hat, dass keineswegs der gefürchtete Quakatz Kienbaums Mörder war, sondern sein Freund Störzer, mit dem er Stunden in trauter Zweisamkeit verbrachte. Auf der anderen Seite dann Heinrich Schaumann, genannt „Stopfkuchen“, der tiefer gräbt, und deshalb auch den Mörder zu identifizieren vermag.
Was uns zum Hauptthema des Romans bringt: der Darstellung des Bürgertums, wie es sich in jeder Kleinstadt findet. Darstellung und Kritik. Denn Eduard ist ja nur ein Beispiel der Stadtjugend, die – zusammen mit ihren Eltern – Quakatz vorverurteilten (obwohl ihm nie etwas bewiesen werden konnte!) und Schaumann wegen seiner körperlichen Nachteile im Graben vor der Roten Schanze liegen ließen. Doch Raabes Kritik ist subtil, denn Schaumann ist auf seine Weise ein ebensolcher Spießbürger wie die Honoratioren der Stadt. Da ist nicht nur äußerlich sein Leibesumfang, der in den Jahren, seit ihn Eduard das letzte Mal gesehen hat, beängstigend gewachsen ist. Da ist der Umstand, dass Schaumann seine Klassiker mit der gleichen Selbstverständlichkeit zitiert, wie es Freund Eduard tut. Da ist die Tatsache, dass er sich seit seinen Universitätsjahren nie mehr weiter weg von der Roten Schanze entfernte als für absolut notwendige Gänge hinunter in die Stadt. Die Art, wie er seine Frau behandelt, macht ebenfalls jedem Spießbürger alle Ehre. Nein, Raabe verurteilt das (Spieß-)Bürgertum keineswegs. Man könnte eher sagen, dass er für ein aufgeklärtes Bürgertum eintritt (die Aufklärung hat gegen Ende des 19. Jahrhunderts ja tatsächlich schon längst spießbürgerliche Züge angenommen).
Ein Roman mit (mindestens einem!) doppeltem Boden also. Worauf uns schon der Untertitel aufmerksam machen will: Die See kommt nur ganz am Rande in der äußersten Rahmenerzählung vor und ist – wie der Kapitän des Schiffs selber feststellen muss – so zahm wie eigentlich selten auf der Route nach Südafrika. Und der Mord ist, juristisch gesehen, gar keiner – es handelte sich um Totschlag im Affekt. Ein gekonntes Spiel Raabes mit seinem Publikum.
Und, ja: einer der besten Romane der Weltliteratur. Man sollte mehr Raabe lesen!