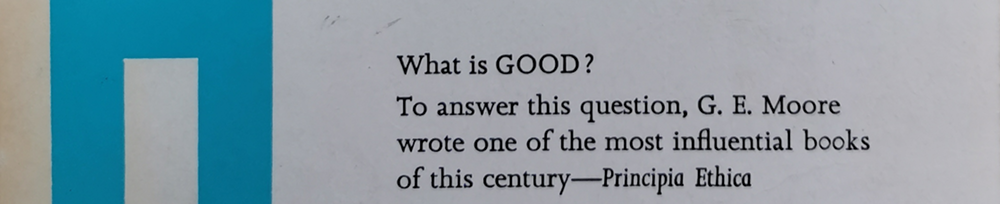Schon der Titel von Moores seminalem Werk soll natürlich an das ebenso seminale Werk eines andern erinnern, nämlich Isaac Newtons Principia Mathematica. Wie Newton die Mathematik und die Physik auf neue Füße gestellt hatte, wollte Moore mit der Ethik vorgehen. Das ist ihm tatsächlich gelungen, und er gilt heute als der erste, der sich der so genannten Meta-Ethik gewidmet hat, nicht also den ethischen Fragen „Welche Handlung ist gut?“ oder „Was ist (meine) Pflicht?“, sondern der Frage: Was ist überhaupt „gut“?, wie definiere ich „gut“? Moores Antwort, die er schon im ersten Abschnitt gibt: Eine solche Definition ist nicht möglich. „Gut“ kann, anders als zum Beispiel „Chimäre“, nicht in einzelne Komponenten zerlegt werden. Denn, wenn die Chimäre aus verschiedenen Bestandteilen besteht, die ich aufzählen und damit dieses Fabeltier definieren kann (Kopf einer Ziege, Körper eines Löwen, Schwanz einer Schlange), besteht „gut“ nicht aus einzelnen, aufzählbaren Teilen. Wir können also von einer Sache nur sagen, dass sie „gut“ ist, oder eben nicht.
(Nebenbei: Die Principia Mathematica von Russell und Whitehead sind erst einige Jahre nach Moores Principia Ethica erschienen – der erste Band 1910, gegenüber der ersten Auflage von Moores Werk im Jahr 1903. Beide Werke sind aber natürlich der damals an der University of Cambridge entstehenden ‚analytischen Philosophie‘ verpflichtet, die – vor allem im Kampf gegen Hegel und den damals in England florierenden Hegelianimus – das Augenmerk auf systematische und konsequente Verwendung der Begriffe legte. Dass sie auf dieser Grundlage Hegel und seinen Schülersschülern noch und noch logisch-semantische Fehlschlüsse nachweisen konnten, versteht sich von selbst.)
Moores Hauptargument in der Fortsetzung seiner Untersuchung ist, was man heute naturalistic fallacy nennt, der naturalistische Fehlschluss. Moore exemplifiziert das an Hand der, wie er sie nennt, hedonistischen oder utilitaristischen Ethik. Um diese zu beurteilen, greift er wiederum zunächst Herbert Spencer an, den „Erfinder“ des Sozialdarwinismus, und weist ihm nach, dass er bei seiner Anwendung der Evolutionstheorie Darwins dessen Sätze missverstanden oder falsch konstruiert hat und so auf eine Bedeutung der Evolution gekommen ist, die von Darwin und den Naturwissenschaften nicht vorgesehen ist.
Es folgt dann der eigentliche Utilitarismus – Bentham, Mill und Moores Zeitgenosse Henry Sidgwick, der eine Ethik auf Grundlage des Utilitarismus vertrat. Moore weist dieser ethischen Richtung nach, dass sie auf Grund des naturalistischen Fehlschlusses versucht, „gut“ zu definieren und so zum Beispiel zu Sätzen kommt wie Pleasure is good, was nach Moore äquivalent ist zu Pleasure is pleasure – eine Tautologie also. Für Moore ist die einzig gültige Unterscheidung die in ‚gut als Mittel (zur Erreichung eines Ziels)‘ und ‚gut als Ziel (einer Handlung)‘. Eine Tugendethik, wie sie zum Beispiel Aristoteles vertreten hat, oder das Christentum, greift zu kurz, denn „Tugend“ ist bestenfalls eine Disposition, „Gutes“ zu tun. (Neben diesen Ausflügen in die Psychologie unternimmt Moore auch welche in die Ästhetik, denn „schön“ ist seiner Meinung nach ein ebenso undefinierbarer Begriff wie „gut“ – ja, „schön“ und „gut“ können sogar schon mal zusammenfallen.
Eine weitere von Moore zurück gewiesene Form der Ethik ist, was er selber Metaphysische Ethik nennt – ein Zurückgreifen auf irgendeine nicht-natürliche Wesenheit, die das Gute sozusagen garantiert. Nicht nur Religionen fallen für ihn unter diese Kategorie, sondern auch die Ethiken der Stoa, Spinozas oder Kants, sowie auch eine Rückbindung der Ethik an die Epistemologie.
Zum Schluss versucht sich Moore dann doch noch in einer praktischen Ethik – nur um festzustellen, dass ‚ein Gutes + noch ein Gutes‘ nicht unbedingt ein mathematisches Plus an Gutem ergibt (so, wie 1 + 1 = 2), sondern zum Beispiel nur 0.5 Gutes. Oder 2.8. Oder auch 0.75 … Es ist hier, wo sich die Verwendung des Begriffs Common Sense bereits zu häufen beginnt, denn Moore kann nicht anders, als immer wieder auf den gesunden Menschenverstand zu rekurrieren, weil sich ethische Problem seiner Meinung nach nicht anders lösen lassen. (Er würde ja später als der große Wiederbeleber der schottischen Common-Sense-Philosophie in die Philosophiegeschichte eingehen.) Es ist auch hier, wo Moore seitenweise im Leeren dreht – der gesunde Menschenverstand eignet sich nun einmal nicht für komplexe philosophische Fragen, weil er meistens zum Schluss kommt: Es kann so sein, es kann aber auch ganz anders sein, und eine dritte und eine vierte Variante sind auch nicht auszuschließen.
Vor allem dieser letzte Teil ist unbefriedigend, auch wenn er wohl eine logische Konsequenz aus seiner These ist, dass „gut“ nicht definiert werden kann. Mit seinen Hinweisen auf schlampige Verwendung von Begriffen, auch bei renommierten Denkern wie Mill, hat Moore der Philosophie zwar einen Dienst erwiesen; es war aber auch zu Teilen ein Bärendienst, denn in den folgenden Jahren sollte sich Philosophie in Sprachkritik erschöpfen, und schlampigen Sprachgebrauch entlarvt zu haben, wurde von einem Mittel der Philosophie zu deren Ziel. (Dies nicht unterscheiden zu können, wirft Moore der utilitaristischen Ethik gerade vor!) Eine Entwicklung, die sich schon in diesem Werk vorgebildet findet. Dennoch oder gerade deswegen kann man das Werk tatsächlich als ’seminal‘ bezeichnen, als wegweisend. Außerhalb der philosophischen Gemeinschaft ist Moore heute wohl eher unbekannt, was schade ist, denn gerade dieses Werk hier könnte auch von Laien problemlos gelesen und verstanden werden. Und ein bisschen mehr auf eigenen und auf fremden Sprachgebrauch und naturalistische Fehlschlüsse zu achten, könnte auch im 21. Jahrhundert nicht schaden …