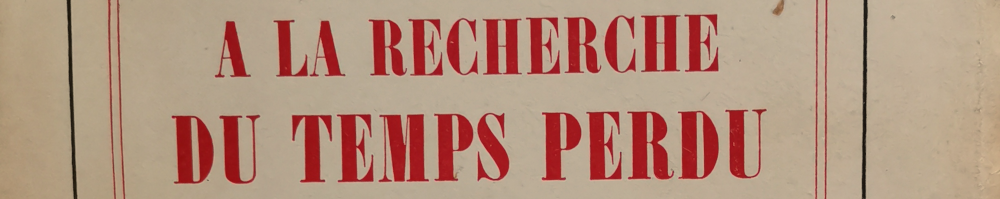Das dritte Buch der Suche nach der verlorenen Zeit fängt gleich mit einem der Zeitsprünge an, die Proust so gern verwendet. Prousts Umgang mit Erzähler und Erzählzeit ist auf jeden Fall ungeheuer faszinierend. Nicht nur, dass er häufig so detaillierte Schilderungen abgibt, dass die erzählte Zeit kürzer ist als die dafür aufgewendete Erzählzeit; dass selbst die Zeit, aus der der Ich-Erzähler erzählt, nicht immer die gleiche ist, weil manchmal offenbar ein Ich erzählt, das unmittelbar in die erzählte Handlung involviert ist, ein andermal aber ein viel älteres Ich die Handlungen und Gedanken des jungen Ich kommentiert; dass er sich Zeitsprünge erlaubt, wie wenn beim erzählenden Ich nun Erinnerungslücken und Gedankensprünge vorkommen – er erzählt auch viel, das weder das damalige Ich und kaum das ältere Ich wissen können. So auch hier.
Nämlich: Wir befinden uns, nach einem relativ kurzen Zeitsprung nun im Hôtel de Guermantes, was kein Hotel ist, sondern der Stadtpalast des Herzogs von Guermantes. Er vermietet offenbar Teile davon, und in so einen Teil ist nun die Familie des Ich-Erzählers eingezogen. Als Grund wird angegeben, dass sich die Gesundheit der Großmutter verschlechtert habe, aber diese Großmutter – eben noch, in Balbec, das Ein und Alles des Erzählers – wird zunächst kaum mehr erwähnt.
Unser Ich-Erzähler lebt nun also in unmittelbarer Nähe seines Kindheitsidols, der Herzogin von Guermantes. Wenn wir nun aber erwarten, dass wir von ihm alles über die Herzogin erfahren, so sind wir auf dem Holzweg. Als allererstes wird nämlich geschildert, wie die Köchin / Bedienstete, Françoise, ihre liebe Mühe hat, sich an den neuen Ort zu gewöhnen. Schließlich helfen ihr dabei weitere Bedienstete, die im Haus leben, und mit denen sie nun jeden Tag ausgiebig frühstückt. Dies sehr zum Ärger des Ich-Erzählers, der sich in diesen Passagen als ungeheuer egoistischer junger Mann zeigt. Er, der trotz allem daran glaubt, dass ihn Françoise gern habe, erfährt auf dem Umweg über den Concierge, dass sie der Meinung ist, er sei nicht einmal den Strick wert, an dem man ihn aufhängen sollte. (Wer nun an die ähnliche Enttäuschung denkt, die die Brüder Goncourt durchlebten, als sie nach deren Tod vom Doppelleben ihrer Bediensteten erfuhren, wird in dieser Passage die literarische Persiflage des daraus entstandenen Romans Germinie Lacerteux der Goncourts sofort erkennen. Wofür die beiden Naturalisten allerdings einen ganzen Roman brauchten, handelt Proust mit ein paar Sätzen im Vorbeigehen ab.) Während im Fall des Stricks erklärt wird, wie der Ich-Erzähler von der Geschichte erfährt, wird nie klar, wie er denn nun die Details des wiedergegebenen Gesprächs der Dienstboten wissen kann.
Nach dieser retardierenden Einführung und dem langen Zwischenspiel des Aufenthalts in Balbec Im Schatten junger Mädchenblüte, des dort geschilderten definitiven Verlusts der Liebe zu Gilberte und des Techtelmechtels mit Albertine (beide werden zu Beginn der Welt der Guermantes noch kurz erwähnt, spielen aber nun keine Rolle mehr, ähnlich also wie die Grossmutter!), knüpft Proust endlich an jene Andeutungen an, die er ja schon im ersten Buch gemacht hat, wo er Swanns Welt in Combray explizit die auf der anderen Seite des Hauses gelegene Welt der Guermantes entgegen gestellt hat. Es handelt sich bei Proust um zwei explizit auch geografisch einander entgegen gesetzte Welten, die er bewusst mit dem Interludium in Balbec von einander getrennt hat, und er drückt dies auch in den Titeln des ersten und des dritten Buchs respektive so aus. (Ich verstehe also nicht, warum die so genannte Frankfurter Ausgabe den Titel des dritten Buchs einfach in Guermantes geändert hat. So gehen wichtige Mikrotext-Fäden verloren, die die einzelnen, nur scheinbar disparaten Bücher der Suche miteinander verknüpfen.)
Abermals sehen wir zu Beginn der Welt der Guermantes einen merkwürdig zwiegespaltenen Ich-Erzähler vor uns. Zum einen kann der nach wie vor sehr junge und unselbständige Mann offenbar nicht anders, als sich in die Herzogin verlieben, als er sie zum ersten Mal aus dem Küchenfenster näher sieht. (Gleichzeitig liefert er eine Beschreibung von ihr, vor allem ihrem Gesicht, die alles andere als schmeichelhaft ist.) Mit dem sicheren Instinkt in Sachen Liebe, die dieser Ich-Erzähler nun einmal hat, wählt er die eindeutig schlechteste Art und Weise, seiner Liebe Ausdruck zu geben. Er hat festgestellt, dass die Herzogin jeden Morgen einen Spaziergang im Quartier macht, jeden Morgen denselben Weg benutzt. Das nützt er aus, um sich jeden Morgen vor ihr aus dem Haus zu schleichen (der Concierge darf ja nichts merken!), sich in jene Straße zu begeben, die die Herzogin benützt, um ihr – ganz zufällig – entgegen zu kommen. Mit sicherem Instinkt kennt er kein Maß und macht das nun täglich. Und mit ebenso sicherem Instinkt tut er manchmal so, als sähe er sie gar nicht oder er schaut gar durch sie hindurch. Er weiß sogar, dass er der Herzogin zum Ekel wird und er beschließt sogar, mit diesem Spiel aufzuhören. Aber da spielt ihm sein Unterbewusstsein einen Streich. Jeden Morgen kommt ihm nun andere Gründe in den Sinn, weshalb er genau zur gleichen Zeit wie die Herzogin durch jene Straße gehen muss – Gründe, die selbstverständlich mit der Herzogin in keinerlei Zusammenhang stehen. (Hier haben wir eine herrliche Episode vor uns, wie sich der ältere Ich-Erzähler ganz subtil über den jüngeren lustig macht.)
Diesem pubertär Liebenden steht jener Mann entgegen, der im Kreis der Unteroffiziers-Freunde von Robert Saint-Loup, mit dem er sich in Balbec befreundet hat, intelligente und komplexe ästhetische und poetologische Reflexionen von sich gibt. Wie schon in Balbec finden wir also einen intellektuell weit fortgeschrittenen Charakter verbunden mit einem in Gefühlssachen nach wie vor kindisch-pubertärem Verhalten bei unserem Ich-Erzähler.
Last but not least ein weiterer Hinweis auf Prousts komplexe Art und Weise zu erzählen. Das oben angedeutete Gespräch entzündet sich an den Vorlesungen über Militärgeschichte, die einer der Vorgesetzten der jungen Unteroffiziere bei deren Ausbildung gab. Es ist nicht Saint-Loup (der dem Ich-Erzähler gegenüber nur Andeutungen gemacht hat) und es ist auch nicht der Ich-Erzähler selber (das wäre zu einfach gewesen!), der dann die Qualitäten dieser Vorlesungen schildert. Sie bestehen nämlich darin, dass zum richtigen Verständnis einer Schlacht auch allerhand Dinge gelehrt werden müssen, die mit der eigentlichen Schlacht in keinem direkten Zusammenhang stehen. Nicht nur die Topografie des Geländes also und die Schlachtpläne der Generäle, sondern auch der Zustand der Soldaten: Sind sie hungrig? Haben sie genug geschlafen? Die Temperaturen und das Wetter allgemein sind natürlich ebenso zu berücksichtigen, wie die persönliche Ausrüstung der Soldaten. So ganz nebenbei und in einem Zusammenhang, der alles andere als offensichtlich ist, erklärt Proust hier seine eigene Auffassung vom Schreiben, erklärt und begründet, warum er immer und immer wieder scheinbar vom Thema abschweift und sich scheinbar in Nebensächlichkeiten verliert. Nur so, sagt er uns hier, kann man das Thema tatsächlich völlig ergründen.
Last but not least: Die im zweiten Buch, Im Schatten junger Mädchenblüte, einige Male kurz erwähnte Dreyfus-Affäre nimmt in diesem Buch nun größeren Raum ein, und wir erfahren, wie sie zum Teil ganze Familien entzweit. Das einzige, das wir nicht erfahren, ist die Haltung des Ich-Erzählers dazu. Proust erlegt hier seinem Erzähler dieselbe Zurückhaltung auf, die er selber beobachtete. Als Sohn einer jüdischen Mutter und Homosexueller war es nicht geraten, sich hier allzu weit vorzuwagen, wenn man nicht – so oder so – zum Märtyrer seiner Meinung werden wollte. (Dass aus der Widmung dieses Buchs an Léon Daudet, der bekannt war für seine extrem konservativen Ansichten – er setzte sich u.a. für eine Wiedereinsetzung der alten Monarchie ein –, eine Übereinstimmung der politischen Ansichten geschlossen werden kann, wage ich zu bestreiten. Es handelt sich dabei wohl mehr um einen kleinen Dank an den Mann, der ihm – als er seinen ganzen Reichtum an der Börse verspekuliert hatte – den Prix Goncourt für den Schatten junger Mädchenblüte erkämpft hatte und ihn so vor dem Bankrott rettete.)
Auch Le côté de Guermantes werde ich in drei Teilen vorstellen. Diese meine Unterteilung hat nichts mit der ursprünglichen Unterteilung in zwei Teile zu tun, die das Buch bei seiner Erstveröffentlichung erfuhr, auch wenn der dahinter liegende Grund in beiden Fällen wohl der gleiche herstellungstechnische ist. Meine Ausgabe stammt aus dem Jahr 1949 (bei Gallimard) und ist eine Broschur mit Interimseinband. Das ganze Buch in dieser Form zusammenzuheften, hätte wohl zu einem Salat an fliegenden Blättern geführt. Ich finde aber die auf diese Weise zu Stande gekommene Länge der Texte gerade gut, um nicht bei der Lektüre zu verzweifeln, sondern im Gegenteil einigermaßen nahe am Text lesen zu können.