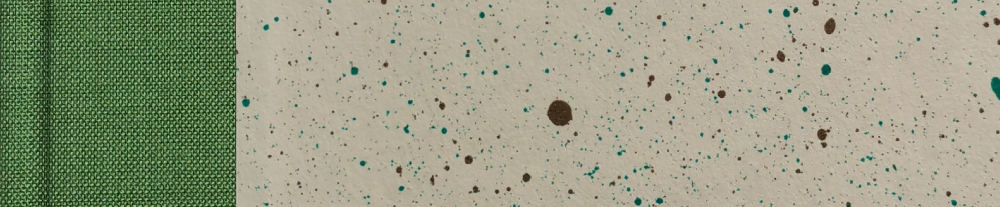Ariosts Orlando furioso war ja die Fortsetzung eines älteren Werks namens Orlando innamorato (Der verliebte Roland) seines Landsmanns Matteo Maria Boiardo. Dieses wiederum stellte eine Parodie dar der altfranzösischen Chanson de Roland und weiterer ähnlicher Sagen. Was mich dann natürlich dazu anstachelte, das Original auch mal wieder zu lesen und hier vorzustellen.
Wobei ‚Original‘ beim Rolandslied cum grano salis zu nehmen ist. Die hier vorgestellte älteste komplett überlieferte Version ist ganz eindeutig nicht die älteste Version, die es je gegeben hat. Aufgefundene ältere Fragmente deuten äußerlich, Wiederholungen ganzer Verse und Brüche in der Gestaltung der Charaktere (vor allem dem von Karl dem Großen) innerlich darauf hin, dass der Turoldus, der sich zum Schluss als ‚Verfasser‘(?) outet (Ci falt la geste que Turoldus declinet – „hier endet, was T. dekliniert hat“; und die Frage ist nun, was Turoldus mit „deklinieren“ gemeint haben könnte, ob ‚verfasst‘ oder nur ‚abgeschrieben‘) nicht unbedingt der ursprüngliche Autor gewesen sein muss.
Anders als Boiardo und Ariost kennt das altfranzösische Rolandslied keine Magie und weist kaum weibliche Figuren auf. Die Liebe kommt also zu kurz; interessanterweise denkt Roland beim Sterben an seine ritterliche Ehre, seinen Ruhm und an la douce France (das süße Frankreich), nicht aber an seine Verlobte Aude. Diese hingegen, als sie von Rolands Tod erfährt, will auch nicht mehr länger leben und – fällt tot hin. Das ist dann aber auch schon alles, was es an Liebesgeschichten hier gibt – wie überhaupt die ganze Erzählung nach heutigen Begriffen sehr trocken abgehandelt wird. Wir finden detaillierte Beschreibungen eines jeden Duells zwischen den Rittern, ansonsten bleiben die Charaktere blutleer, und das schon, bevor sie in der Schlacht tatsächlich alles eigene und fremde Blut vergossen haben.
Inhaltlich orientiert sich das Rolandslied sogar an historischen Fakten. Karl der Große war tatsächlich eine Zeitlang in Spanien damit beschäftigt, die Sarazenen zu bekämpfen. Er hat tatsächlich versucht, Saragossa einzunehmen und ist daran gescheitert. Und auf dem Rückzug ist offenbar tatsächlich seine Nachhut in einen Kampf verwickelt und aufgerieben worden. Aber im Rolandslied ist auch einiges anders: Was hier zum Beispiel verschwiegen wird, ist der Umstand, dass es wahrscheinlich keine Sarazenen waren, die die Nachhut angegriffen. Die Hintergründe waren andere und für die ritterliche Ehre Karls des Großen wenig schmeichelhafte. In der Realität war es nämlich so, dass Karl der Große – warum auch immer – die eigentlich befreundete christliche Stadt Pamplona seinen Truppen zur Plünderung freigab. Es waren dann wahrscheinlich christliche Basken, die aus Rache einen Hinterhalt legten. Im Übrigen kann es tatsächlich so gewesen sein, dass ein gewisser Hruotland (französisiert Roland), der als Roland von Cenomanien, Markgraf der bretonischen Mark des Frankenreichs, in den Geschichtsbüchern zu finden ist, diese Nachhut angeführt hat – dass Hruotland mit Karl verwandt war wie im Lied, ist dann wiederum nicht bekannt.
Es gibt Theorien, wonach das Rolandslied den Übergang von einer alten, aus der Zeit der Völkerwanderung stammenden Verehrung des individuellen Helden (Roland) hin zur normannischen Heeresdisziplin beschreibt. Ob gewollt oder nicht, aber tatsächlich kann das das aus heutiger Sicht seltsam inkonsistente Verhalten Rolands wie Karls des Großen ein wenig aufhellen. Als die Nachhut nämlich von den Sarazenen angegriffen wird, und ihn sein bester Freund Olivier darum bittet, in Olifant, sein Kriegshorn, zu stoßen, weigert sich Roland, der der Meinung ist, mit diesen Gegnern müsse er alleine fertig werden. Diese Hybris wird an ihm und der ganzen Nachhut bestraft, und er kann das erst gut machen, als er – bereits im Sterben liegend – dann doch noch ins Horn stößt. Karl und der Rest des Heeres kehren denn auch sofort um und vertreiben, die Heiden. Ja, sie reiben diese völlig auf. Auch das Verhalten Karls wirft immer wieder Fragen auf. Da gibt es Momente im Kriegsrat, in denen er selbst seine engsten Vasallen recht rüde zurechtweist und auf seine Position pocht, während er andererseits den Verräter Ganelon, der von seinen Vasallen und Verwandten geschützt wird, erst zur Rechenschaft ziehen kann, nachdem einer seiner Männer das Oberhaupt der Meute um Ganelon im Zweikampf getötet hat.
Die Sarazenen sind im Rolandslied als Heiden gekennzeichnet Dessen Verfasser war offenbar der Meinung, Mohammed sei einer ihrer Götter, neben zum Beispiel Apollon. Von religiöser Toleranz kann in diesem Epos keine Rede sein. Dafür ist la douce France in aller Christen Munde – kein Wunder stieg das Rolandslied im Zuge des aufkommenden Nationalismus zum französischen Nationalepos auf.
Zum Schluss noch ein Wort zu meiner Übersetzung. Sie stammt von einem gewissen Dr. Wilhelm Hertz. Der lebte von 1835 bis 1902 und war Schüler zunächst von Ludwig Uhland (dem er auch diese Übersetzung gewidmet hat), dann von Paul Heyse und zu seiner Zeit als Schriftsteller nicht unbekannt. Ich habe die Übersetzung nun nicht mit dem Original verglichen, aber sie scheint in Ordnung zu sein. Hertz‘ Anmerkungen stammen aus der romantischen Philologie, aus der Hertz selber ja auch stammt, und sind heute wohl überholt, aber dennoch oft erhellend.
Fazit: Das ‚originale‘ Rolandslied öffnet ein Fenster in eine völlig andere Zeit, als die Helden noch tapfer und eigensinnig und die Epen noch trockene Aufzählungen von Schlägereien waren.