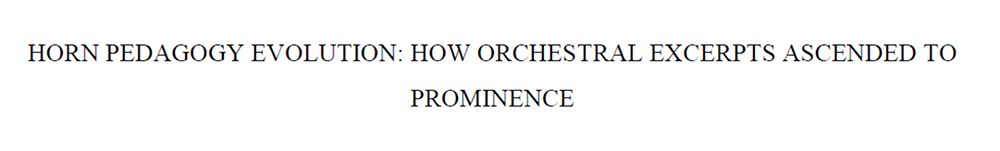Dissertationen sind, was Dissertationen halt so sind. Meist handelt es sich um Spezialuntersuchungen zu einem Spezialthema – Mikrospezialisierungen in irgendeiner kleinen Ecke des ganzen grossen Fachgebiets. Als Laie kann man dann jeweils nur noch hoffen, dass solche Dissertationen zumindest dem Doktorvater (bzw. der Doktormutter) helfen, den Überblick über ein etwas grösseres Ganzes zu erhalten. Das gilt zumindest im Gebiet der Geistes- und Sozialwissenschaften. In der Medizin sind Dissertationen noch einmal etwas anderes, da die eigentliche Ausbildung der Ärzte vor der Doktorarbeit stattfindet, diese nur noch fürs Schild an der zukünftigen Praxis ist. Vor mir liegt eine musikwissenschaftliche Dissertation; und für Musiker ist die Situation ähnlich wie für Ärzte: Auch für sie findet die eigentliche Arbeit – das Erlernen und Perfektionieren eines Instruments – vor und ausserhalb der akademischen Dissertation statt.
Die hier liegende Arbeit beschäftigt sich genau mit dieser ausserakademischen Arbeit am Instrument. Der Autor, selber Hornist, hat sich die Lehrmittel für Hornisten einmal genauer angesehen. Eigentlich sogar nur die Art und Weise, ob, und wenn ja wie, darin Auszüge aus „echten“ – also nicht speziell für den Unterricht erstellten – Kompositionen vorkommen. (Auch das natürlich unterdessen typisch für Dissertationsthemen in den Geistes- und Sozialwissenschaften: Mehr und mehr wird nicht mehr Sekundärliteratur verfasst, sondern gleich Tertiärliteratur: Arbeiten über Sekundärliteratur – wozu ich jetzt auch Unterrichtswerke zähle.)
Unterrichtsmaterial, so eine der Feststellungen von Huebscher, richtet sich „nach dem Markt“. Während es zu Beginn der von ihm untersuchten Epoche (das früheste Lehrmittel, das er vorstellt, stammt aus dem Jahr 1746) Usus war, dass es kaum Standard-Stücke gab (also auch noch keine fixierten „Klassiker“, die der Instrumentalist zu kennen hatte, weil sie das Publikum von ’seinem‘ Orchester erwartete), dass es noch keine Auditionen gab, die der angehende Orchester-Musiker zu bestehen hatte, um beschäftigt zu werden (heute nennt man das „Casting“ – früher ging man einfach hin und spielte mit – oder eben auch nicht), ja dass vielfach das Orchester an einem Hof stand und im Grunde genommen einfach aus Dienern bestand, die auch noch musizierten*), und die Orchester (wo sie eben nicht für einen bestimmten Fürsten spielten – dort waren Opern wichtig) meist reine Instrumentalstücke spielten, so traten später die für ein breites Publikum spielenden Orchester in den Vordergrund. Die waren dann im 19. Jahrhundert vor allem für die Begleitung von Opern zuständig; erst spät bildete sich das stehende, professionelle Orchester der Neuzeit heraus. Diese nunmehr nicht mehr einem einzelnen Fürsten verpflichteten Orchester hielten auch Auditionen, wenn es darum ging, Abgänge zu kompensieren. Mehr und mehr bildete sich für diese Auditionen eine Art Kanon aus dessen, was von einem angehenden neuen Mitglied erwartet wurde. Und dieser Kanon fand natürlich Eingang in die Lehrwerke. Exzerpte aus Orchester-Stücken und Opern-Partituren wurden die Regel für Lehrmittel.
Daran änderte offenbar erst das späte 20. und das frühe 21. Jahrhundert etwas Substanzielles, indem die doch immer beschränkte Anzahl an vorhandenen Lehrmitteln und Exzerpten durch das Internet de facto ins Unendliche vermehrt wurden. Jeder konnte, so er wollte, einen eigenen Kanon bilden und auch entlegenste Literatur öffentlich machen. (Dieser Aspekt wird zwar vom Autor zum Schluss seiner Arbeit kurz erwähnt, hätte aber meiner Meinung nach ausführlicher behandelt werden können.)
Als interessierter Laie habe ich somit weniger etwas über den pädagogisch-technischen Aspekt des Hornspielens erfahren, dafür aber umso mehr über die Geschichte der Aufführungs- und Spielpraxis im Allgemeinen während der letzten rund 250 Jahre. Das ist mehr, als ich von einer Dissertation über ein entlegenes Spezialthema erwarten durfte.
*) Aber immerhin waren auch damals schon Exzerpte aus Händels Wassermusik zu finden – arrangiert als Duett zwischen Lehrer und Schüler.