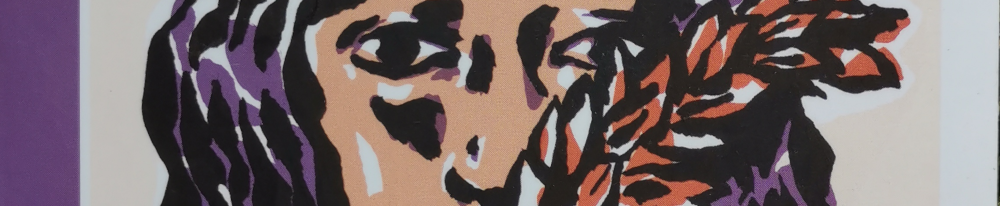Im November 1670 kamen im Abstand von nur wenigen Tagen zwei neue Dramen zum Thema der Liebesgeschichte von Berenize und Titus auf die Bühne. Das um wenige Tage früher uraufgeführte, stammte von Jean Racine und hieß einfach Bérénice, das andere war von Pierre Corneille und nannte sich Tite et Bérénice. Denselben kurzen Abstand untereinander hatten die beiden Stücke auch im kurz auf die Uraufführung folgenden Druck; auch hier war Racine der schnellere.
Die Geschichte von Titus und Berenize ist höchst wahrscheinlich historisch; jedenfalls wird sie auch von den antiken römischen Geschichtsschreibern überliefert. (Was natürlich noch keine völlige Sicherheit bedeutet; die antiken Historiker füllten gern Lücken im Lebenslauf der Kaiser und verwendeten auch oft Gerüchte und gar üble Nachreden – teils, weil sie es nicht besser verstanden, teils auch aus mehr oder weniger bösem Willen.) Das Gerüst der Geschichte lässt sich wie folgt zusammenfassen: Titus, der Sohn des römischen Kaisers Vespasian hat auf den palästinensischen Feldzügen, die er zusammen mit seinem Vater und seinem Bruder Domitian durchführte, die hasmonäische Königin Berenize kennen und lieben gelernt. Die Liebe war gegenseitig, und als Titus zurück nach Rom gerufen wurde, weil sein Vater im Sterben lag und er den Kaiserthron übernehmen sollte, kam Berenize mit ihm. Doch die Liebesbeziehung scheiterte an der politischen Realität. Der Kaiser als Führer des römischen Staats durfte nur mit einer Bürgerin Roms verheiratet sein. Dieses Problem war zwar noch von Vespasian aus dem Weg geräumt worden, als er Berenize das römische Bürgerrecht verliehen hatte. Die römische Verfassung aber (oder was seine Stelle einnahm) verbot auf das Strikteste, dass je ein König (oder eben eine Königin) wieder den Staat leiten sollte. Berenize und Titus trennten sich, sie kehrte zurück in ihre Heimat und verschwand aus der Geschichte Roms und damit der Weltgeschichte, wie wir sie kennen.
Wir sind es aus der Geschichte der deutschen Literatur gewöhnt, dass die großen Dramatiker der Klassik, Goethe und Schiller, nach anfänglichen Animositäten zu einer äußerst fruchtbaren Zusammenarbeit und Freundschaft fanden. Anders in Frankreich, wo die Klassik rund 125 Jahre früher stattfand, zur Zeit des Sonnenkönigs Louix XIV, im Barock. Es existierten als Gradmesser des Erfolgs im Grunde genommen nur Paris und der Königshof. Lange Zeit war Pierre Corneille der unangefochtene Dramatiker der Zeit, und Jean Racine, 33 Jahre jünger, machte harte Zeiten durch beim Versuch, den älteren von diesem Thron zu stossen. 1670 war es dann schon so weit, dass Racine unbeschränkten Zutritt zu Colbert, dem damals allmächtigen Minister Louis’ XIV hatte. Wer auf die Idee gekommen war, die beiden Titanen gleichzeitig mit einem Stück zum Thema ‚Titus und Berenize‘ aufeinander zu hetzen, lässt sich heute nicht mehr rekonstruieren.
Jedenfalls endete die Konfrontation mit einem Sieg nach Punkten Racines. Das Pariser Publikum strömte in Scharen zu den Aufführungen von Bérénice und selbst der König wünschte eine Aufführung des Stücks an seinem Hof. Wenn wir nun Corneilles Tite et Bérénice auch nur schon lesen, wird rasch klar, warum er verlieren musste. Wo Racine heiße Gefühle auf die Bühne bringt und überschwappende Emotionen, zeigt uns Corneille kühle machtstrategische Überlegungen. Deshalb lässt er das Stück chronologisch gesehen sogar als eine Art Fortsetzung des Racine’schen beginnen. Im Grunde genommen wären alle Emotionen schon erledigt: Berenize ist abgereist und die in Rom Zurückgebliebenen beginnen sich zu sortieren. Es geht um Fragen der Macht, des Fortbestehens der flavischen Dynastie. Titus ist unverheiratet, und es stellt sich die Frage, wen er heiraten soll. Es würde sich eine gewisse Domitia anbieten (genauer: Domitia Longina), Tochter eines von Nero zum Selbstmord gezwungenen Generals, der von seinen Truppen – wie es halt manchmal so geschah – schon zum römischen Kaiser ausgerufen worden war. Domitia fühlt sich also selber aus kaiserlichem Geblüt und will unbedingt herrschen. Zwar liebt sie Titus’ Bruder Domitian – so weit man in Corneilles Stück eben von Liebe sprechen kann. Denn als man zum Schluss gekommen ist, dass sie den Titus heiraten sollte, ist sie die Person, die am wenigsten Widerstand leistet. Doch dann kommt es anders, bzw. es kehrt eben Bérénice noch einmal nach Rom zurück.
Somit haben wir im Folgenden nicht nur ein Dreieck wie bei Racine sondern gar ein Viereck: Titus und sein viel jüngerer Bruder Domitian, Bérénice und Domitia. Ginge es nach den Gefühlen, wäre die Sachlage klar. Aber die Fragen der Macht und der Erhaltung der Dynastie gehen vor. Es ist ja schon bezeichnend und zeigt ganz klar den Schwerpunkt, den Corneille gelegt hat, dass die beiden Figuren, die seinem Stück den Titel geben, Titus und Bérénice, im ganzen ersten Akt gar nicht auftreten. Auch sonst sind es nicht die großen Gefühle, sondern der rhetorische Schliff der jeweiligen Wechselreden, die interessieren. So geht es fünf Akte lang hin und her; jede erdenkliche Kombination des Personals wird erwogen – sogar, dass Titus die Domitia heiratet und Domitian die Bérénice (mit dem schweigenden Verständnis, dass die beiden Brüder die jeweils andere Frau zur Geliebten haben).
Zum Schluss ist es Bérénice, die den gordischen Knoten durch haut und beschließt wieder, und dieses Mal für immer, abzureisen. Sie ist denn auch im Stück vielleicht die einzige, bei der man wirklich von Gefühlen sprechen könnte. Damit macht die Königin aus Palästina aber Platz für eine andere Lösung: Titus bleibt unvermählt, ernennt Domitian zu seinem Nachfolger und Co-Regenten, dieser wiederum heiratet Domitia (die, als dies auf der Bühne beschlossen wird, gar nicht anwesend ist – es also einfach über sie verfügt wird, nachdem sie sich darin zu gefallen begann, neben Titus als Kaiserin zu fungieren).
Was wie ein Happy Ending klingt (und den Titel Comédie héroique, den ihr Corneille gab, rechtfertigen würde), ist aber keines, wenn wir lesen, was der Autor in der Buchausgabe an Stelle eines klassischen Vorworts gestellt hat. Da finden wir nämlich zwei Auszüge (Regeste) aus dem Geschichtswerk des Cassius Dio (von einem byzantinischen Mönch verfasst), in denen unter anderem zu lesen ist, dass Titus in seinem Leben nur eine einzige Sache getan habe, die er nun, auf dem Sterbebett, bereue. Er habe aber nicht (mehr?) sagen können, welche das gewesen sei. Es ist an der Nachwelt zu spekulieren, was er gemeint haben könne. Dass er sich nicht für Berenize entschied damals? Oder dass er Domitian zum Mitregenten ernannt hatte? (Cassius Dio teilte die Abneigung des römischen Senats gegen Vespasians jüngeren Sohn, der sich erlaubt hatte, ohne Einbezug des Senats zu regieren, und dem deshalb allerhand Laster angedichtet wurden – unter anderem auch die Vergiftung seines Bruders Titus.) In der historisch-politischen Perspektive, die bei Corneille wichtiger ist als der Liebesroman, gibt es kein Happy Ending, keine endgültig richtige Entscheidung. Doch das wollten oder konnten weder das Pariser Publikum noch der König hören – dem Corneille dazu noch mehrere Male in diesem Stück unter die Nase rieb, dass auch ein absolut regierender Herrscher immer noch Rücksicht auf den Staat als Ganzes zu nehmen habe – was der vorbildliche Kaiser Titus natürlich tut.
Emotional wäre also Racine vorzuziehen, intellektuell Corneille. Heute können wir den Kampf der Titanen als unentschieden werten.
Gelesen habe ich die beiden Stücke in folgender Version:
Jean Racine: Bérénice / Pierre Corneille: Tite et Bérénice. Présentation et notes de Dominique Moncond’huy. Paris, La Table Ronde, 1998.