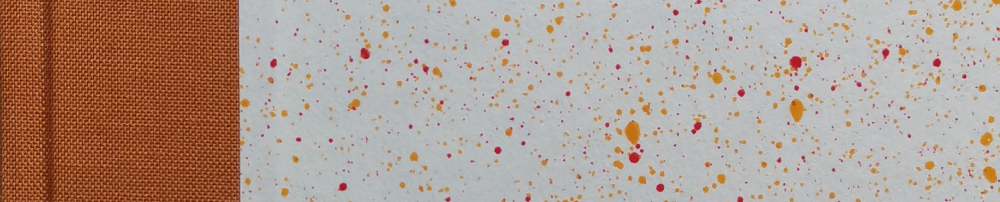L’Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut (meist kurz Manon Lescaut) von Antoine-François Prévost d’Exiles (meist kurz, auf Grund seiner Priesterweihe, Abbé Prévost) nimmt im Werk seines Autors eine ähnliche Ausnahmestellung ein wie Les liaisons dangereuses in demjenigen seines Autors Choderlos de Laclos. Beide Romane sind nämlich das einzige, was aus dem Gesamtwerk der jeweiligen Autoren bis heute noch gelesen wird – also in einem gewissen Sinn zur Weltliteratur gezählt werden kann.
Es gibt allerdings signifikante Unterschiede. Während das literarische Werk des Berufsoffiziers Laclos ohne Probleme in einem Band Platz findet, brauchte es für die des (nicht wirklich berufenen) Geistlichen deren acht in der neuesten Ausgabe, deren 39 gar in der ersten Sammlung seiner Werke. Eine gewisse Geschwätzigkeit kann man dem Abbé also nicht absprechen.
Während Laclos’ Briefroman sehr detailliert konstruiert ist, unterschiedliche Briefschreiber und -schreiberinnen einander kreuz und quer anschreiben, Briefe sich kreuzen, verloren gehen oder vom fiktiven Herausgeber weggelassen werden, jede Person ihre eigene Stimme erhält, ist Manon Lescaut nach dem relativ simplen Modell von Rahmen- und Binnenerzählung konstruiert. Beide werden von einem Ich-Erzähler präsentiert.
Während Laclos in seinem Roman subtil die Drähte aufzeigt, an denen die Marionetten seiner Figuren aufgehängt sind, an denen sie ziehen und gezogen werden, haben wir bei Prévost die simple Geschichte eines Amour fou: Der 17-jährige Chevalier des Grieux – ein Ritter deshalb, weil er bereits für den Dienst im Malteser-Orden vorgesehen ist – verliebt sich auf der Straße in eine junge Frau, die auf einem Karren mit anderen jungen Frauen vorbeigefahren wird. Der Trupp ist auf dem Weg in ein Arbeitshaus. Es handelt sich bei den Frauen um Prostituierte. Der junge Mann unternimmt alles, um bei dieser seiner plötzlichen Liebe sein zu können. Sie scheint ihn ebenfalls zu lieben – jedenfalls denkt er das. (Genaues können wir nicht wissen, weil immer nur aus seiner Sicht erzählt wird.) Die Geschichte ist eine des Sich-Findens und wieder Verlierens, und auch eines gesellschaftlichen Abstiegs des Chevaliers. Zum Schluss wird Manon dazu verurteilt, in die Strafkolonie von Nouvelle Orléans gebracht zu werden, damals, so der Erzähler, ein kleines Kaff von rund 600 Holz- und Lehmhütten. Er weiß es, denn es gelingt ihm, mit demselben Schiff wie Manon nach Amerika überzufahren. Doch auch dort ist keine Ende ihrer Schwierigkeiten, selbst aus der Strafkolonie müssen sie flüchten. Schließlich stirbt Manon an Auszehrung in der Wüste und des Grieux kehrt nach Frankreich zurück, wo er den Ich-Erzähler der Rahmenhandlung trifft und ihm sein ganzes Leben erzählt.
Kein Wunder, hat Laclos’ Roman immer wieder auch schreibende Kolleg:innen interessiert und fasziniert. Kein Wunder wohl auch, hat Manon Lescaut vor allem – Opernkomponisten angeregt. Nennenswert sind Manon von Jules Massanet (der später auch aus Den Leiden des jungen Werthers (inhaltlich, nicht musikalisch!) eine Liebesschmonzette machte), Manon Lescaut von Giacomo Puccini (der später auch mit Madama Butterfly eine andere Geschichte einer unglücklichen Liebe auf die Bühne stellen würde) und Boulevard Solitude von Hans Werner Henze (der sich von den hier Genannten (es gibt noch mehr!) wohl am weitesten vom Original entfernte, die Handlung in die Gegenwart des 20. Jahrhunderts verlegen ließ und als ein Paradebeispiel der Einsamkeit des modernen Menschen interpretierte).
Ich weigere mich im Übrigen bewusst, für die Geschichte des Chevalier des Grieux und der Manon Lescaut den Begriff einer „tragischen Liebe“ zu verwenden. Denn „tragisch“ im strikten Sinn ist nichts in diesem Roman. Eine Umkehr wäre jederzeit möglich gewesen. Tragisch ist allenfalls die Dummheit des Chevaliers, der jedes Mal die falsche Entscheidung trifft, sowie dessen Unbeherrschtheit, die an den Verfolgungen, die die beiden treffen, in hohem Grad mitschuldig ist.
Unsterblich, bzw. eben ‚Weltliteratur‘ also vor allem deshalb geworden, weil es sich hier letzten Endes um eine tief sentimentale Liebesschmonzette handelt. Als literarisches Werk vernachlässigbar.
Gelesen in der Übersetzung von Karl Görke.