Offiziere in der königlich-französischen Armee des 18. Jahrhunderts hatten – wenn nicht gerade Krieg war – meistens recht viel Freizeit, in der sie mehr oder weniger treiben konnten, was sie wollten. Viele fühlten sich dann zu literarischer Produktion getrieben. Sie versifizierten, was das Zeug hielt, und oft wurden diese Verse auch veröffentlicht. Geld hatte man ja. So ein Offizier war auch Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos (im Deutschen meist nur „Choderlos de Laclos“, auf Französisch sogar nur „Laclos“). Mit einer kurzen Unterbrechung unter Robespierre war er zeitlebens professioneller Soldat und beendete sein Leben als General und Festungskommandant unter Napoléon. Nichts Außergewöhnliches an ihm und seiner literarischen Produktion – wenn da 1782 nicht aus heiterem Himmel Les liaisons dangereuses erschienen wäre. Man stelle sich vor: Ein bisher literarisch nicht weiter aufgefallener Offizier veröffentlicht plötzlich den bis heute wohl besten Briefroman der Weltliteratur, dem dann auch in seinem restlichen Werk nichts qualitativ Vergleichbares mehr folgt. (In Frankreich wird sein unvollendeter Essay De l’éducation des femmes seit 1908 aktuell ebenfalls eigenständig veröffentlicht; ansonsten existiert nur noch eine kritische Werkausgabe.)
Mit Les liaisons dangereuses ist Laclos das Kunststück gelungen, einen ‚echten‘ Briefroman zu schreiben: Wir finden verschiedene Gesprächspartner, die sich untereinander in verschiedenen Konstellationen schreiben; wir finden Antworten, die verspätet eintreffen und Briefe, die sich kreuzen; wir finden vor allem eine je verschiedene Stimme für jede:n Briefschreiber:in. Kein Wunder, hat der Roman im deutschen Sprachraum vor allem auch schreibende Kollegen fasziniert – sowohl Franz Blei wie Heinrich Mann haben ihn übersetzt. (Mann war auch, wenn ich das richtig sehe, der erste, der den Titel – der ja eigentlich mit „Gefährliche Verbindungen“ übersetzt werden müsste, mit „Gefährliche Liebschaften“ wiedergegeben hat, nicht ganz zu Recht, denn es geht in diesem Roman um mehr als nur um Liebschaften.)
Laclos zeichnet in seinem Roman ein Bild der besseren Gesellschaft gegen Ende der Herrschaft von Louis XVI. Die meisten Briefe sind lang, manchmal aus heutiger Sicht langatmig, denn die Damen und Herren haben jede Menge Zeit zur Verfügung. Sie sind, wie die Herausgeberin meiner Ausgabe es formuliert, empfindsam geworden, weil sie nichts zu tun haben, keine Beschäftigung kennen außer sich selber. Der absolutistische König hielt ganz bewusst seinen Adel – mit Ausnahme von ein paar Profis – von jeder administrativen, judikativen oder militärischen Tätigkeit fern. So saß man da, auf seinem Landsitz, so man einen hatte, oder in Paris. Die Herren verbrachten ihre Zeit mit Spielen, mit Dichten oder mit Jagen; die Damen stickten und kriegten Kinder. Oder man dachte an – Sex. Nur: Es galten in dieser äußerst verfeinerten Gesellschaft äußerst verfeinerte, aber rigide Regeln, wie man sich zu benehmen hatte – auch und gerade in puncto Eros und Amor.
Der Roman erzählt nun die Geschichte, wie ein paar Menschen zu Grunde gehen, die diese Spielregeln nicht einhielten – entweder, weil sie es nicht wollten, oder weil sie zu ungeschickt dazu waren. Man pflegt üblicherweise die aktiven Teilnehmer an diesem gefährlichen Gesellschaftsspiel, die Marquise de Merteuil und den Vicomte de Valmont, als die Bösewichtin und Bösewicht des Romans zu behandeln, die denn auch zum Schluss bestraft werden. Das ist meiner Meinung nach falsch. Der Unterschied zwischen den Beiden auf der einen Seite und den übrigen Protagonist:innen ist vielmehr der, dass sie eben aktiv ins Spiel eingreifen. Sie glauben, die Spielregeln perfekt zu kennen und zu beherrschen, weshalb sie denken, sie gegen andere ausspielen, oder genauer: für sich anwenden, zu können, andere manipulieren zu können. Ihr Fehler ist es, dass sie von einem gewissen Zeitpunkt an dieses Spiel nicht mehr leidenschaftslos spielen. Der Vicomte de Valmont verliebt sich ernsthaft in eines der Opfer, das er ursprünglich nur für eine Nacht verführen wollte; die Marquise de Merteuil wird deshalb wütend und wohl auch eifersüchtig auf ihren ehemaligen Verehrer. Sie verlieren beide die Beherrschung und damit die Kontrolle über das Spiel. Ihre Opfer sind vor allem deshalb Opfer, weil sie entweder gar nicht merken, welches Spiel gespielt wird (dass ein Spiel gespielt wird), oder weil sie zu ungeschickt sind, die subtilen Spielregeln wirklich befolgen zu können. Zum Schluss gehen sie alle zu Grunde, nicht nur die so genannten Bösen. Übrig bleiben jene, die sich vom Spiel ferngehalten haben. Ihr Triumph wirkt schal, denn zumindest können die Teilnehmenden von sich behaupten, etwas erlebt zu haben, selbst wenn sie den Rest ihres Lebens im Kloster zubringen oder im Exil auf Malta. (Das ist der einzige Wermutstropfen in diesen Roman: Zum Schluss verfällt Laclos, im Vierten Teil des Romans, wieder der hergebrachten, barocken Manier, sich die ganze Katastrophe, ohne Vorwarnungen, für den letzten Akt des Dramas aufzubewahren. Weshalb der Schluss – nachdem es vorher für unsere modernen Augen kaum vorwärts ging – plötzlich alles auf einmal abhandelt, alle auf einen Schlag bestraft.)
Ein gefährlicher Solitär, diese Gefährlichen Verbindungen. Die Gesellschaft, die er schildert, existiert heute nicht mehr in dieser Form. Aber man könnte den Roman mutatis mutandis für einige Influencer:innen auf Instagramm oder YouTube neu schreiben …
Meine Ausgabe:
Choderlos de Laclos: Gefährliche Liebschaften oder Briefe gesammelt in einer Gesellschaft und veröffentlicht zur Unterweisung einiger anderer. Aus dem Französischen von Wolfgang Tschöke. Mit einem Nachwort von Elke Schmitter. München, Wien: 2003. [Gelesen in einer Lizenzausgabe der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft – die Ausgabe stammt halt noch aus einer Zeit, als Winkler schön gemachte und gut editierte Ausgaben von Klassikern der Weltliteratur in Dünndruckausgaben herstellte und die WBG diese als Lizenz weitergab. Tempi passati.]

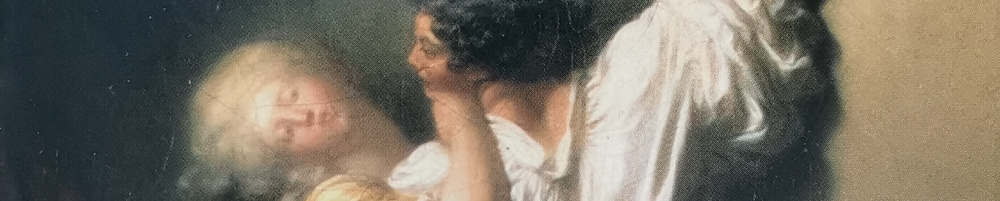
1 Reply to “Choderlos de Laclos: Gefährliche Liebschaften [Les liaisons dangereuses]”