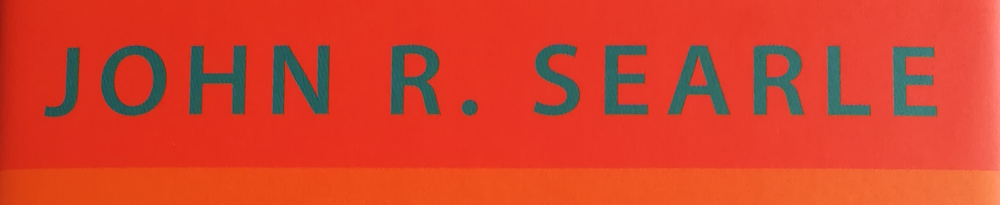Searles Ausgangspunkt ist der Umstand, dass der Mensch das einzige uns bekannte Tier ist, das neben einer physischen Realität auch noch eine soziale Realität kennt bzw. anerkennt. Wenn ich beim Spazieren-Gehen nicht aufpasse und mir die Nase an einem Baum stoße, dann ist das eine physische Realität. Stoße ich sie mir an einer Straßenbahn, wird es komplizierter. Einerseits ist das Ding da aus Blech und andern Materialien durchaus eine physische Realität. Andererseits dient die menschengemachte Form der physischen Realität „Straßenbahn“ einem sozialen Zweck, den ich z.B. implizit anerkenne, wenn ich morgens früh ebendiese Straßenbahn nehme, um zur Arbeit zu fahren. Die physische Realität ist da – die soziale Realität „machen wir uns“, so Searle.
Die Art, wie wir sie uns machen, will Searle im vorliegenden Buch untersuchen und erklären. Er greift dazu auf zwei Begriffe früherer Philosophen zurück: auf die Intentionalität Franz Brentanos und auf den Sprechakt John L. Austins. Er wandelt dabei beide zu seinen Zwecken ab. „Intentionalität“ bezeichnet bei Brentano die Fähigkeit des Menschen, sich auf etwas zu beziehen. Nach Searle ist es so, dass es nach oben und nach unten gerichtete Intentionalität gibt: Sie geht entweder vom Objekt zur Welt oder eben umgekehrt. Was vom (physikalischen?) Objekt zur Welt geht, bildet die physische Realität, was den umgekehrten Weg geht, die soziale. Es braucht für letzteres noch mehr, und dieses „Mehr“ trägt die Sprechakt-Theorie hinzu. Bei Austin ist der Sprechakt mehr oder weniger einfach die physische Beschreibung der Art und Weise, wie der Mensch Laute hervorbringt bzw. diese zu Wörtern und Sätzen verkettet. Einige seiner Schüler und Nachfolger, darunter auch Searle, kennen zusätzlich sog. illokutionäre Rollen, bei denen die Sprechakt-Theorie dann zu einer speziellen Zeichentheorie mutiert. Dies gilt vor allem für bestimmte Verben wie „bitten“ oder „befehlen“, aber auch für die Modalverben, die nach Searle in der Lage sind, eine Art eigener Welt zu bilden mit eigenen Wahrheitsbestimmungen – eben die soziale Welt. Nun ist nicht jeder in gleichem Masse befähigt und berechtigt, eine soziale Welt zu bilden, die auch für andere verbindlich ist. Hier kommt das in einem eigenen, 50 Seiten langen Kapitel diskutierte Problem der Macht hinzu, insbesondere der deontischen Macht – der Pflicht. Ich bin als Mensch verpflichtet, die Rechte anderer Menschen zu respektieren; rein egoistisches Verhalten ist möglich (unsere Spitzenbanker beweisen es täglich), wird aber früher oder später zur Kollision mit anderen Mächten führen.
Mit dieser Theorie glaubt Searle, die ontologischen Grundlagen der Sozialwissenschaften gelegt zu haben. Dass er in einer Petitio Principii das Zu-Erklärende (die soziale Wirklichkeit) bereits im Erklärenden drin hat, in der Intentionalität, die eine Art Mentales voraussetzt, in der sich eigene Wirklichkeiten bilden können, in seiner modifizierten Sprechakt-Theorie, die mit seinen performativen Verben bereits Soziales voraussetzt, blendet er aus. Im Grunde genommen ist Searle in diesem Buch (das er, der Hybris verfallend, in Einstein’scher Manier die allgemeine Theorie der Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit nennt, um es von seinem Vorgänger, der Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit: Zur Ontologie sozialer Tatsachen von 1995) zu unterscheiden, die eben die spezielle Theorie gewesen sein soll (ich kenne dieses Buch nicht) – so wenig wie Foucault, auf den er sich stützt, ist Searle also hier im Grunde genommen nicht weiter, als es schon Wittgenstein in seinen Philosophischen Untersuchungen war: Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache; wir spielen ein Sprachspiel, und die Regeln dieses Spiels ändern wir auch schon mal unterm Spielen. In der hinter der Macht liegenden Pflichtethik haben wir letzten Endes sogar noch immer Kant vor uns. Und ein Problem bleibt ungelöst: Es besteht bei Searle zwischen dem Innen (= mir) und dem Außen (= dem Druck der gesellschaftlichen Realität) immer eine Lücke: Der Physik kann ich nicht anders als gehorchen – ich falle, wenn ich stolpere, immer zu Boden, nie steige ich in die Luft. Aber ich kann – zumindest theoretisch, zumindest in einem gewissen Ausmaß – den Gesetzen der Gesellschaft die Gefolgschaft verweigern. Diese Lücke füllen andere Philosophen mit dem Konzept der „Willensfreiheit“; Searle muss beim Begriff „Lücke“ bleiben, weil eine Anerkennung von „Willensfreiheit“ mit seiner Anerkennung physikalischer Grundprinzipien der menschlichen Konstruktion kollidiert.
Wobei: Searles Rückbindung an die naturwissenschaftlichen und biologischen Aspekte der Sprache beschränkt sich auf den hin und wieder vorkommenden Hinweis, dass selbstverständlich alles, was in unserm Kopf vorgehe, auf physikalischen und chemischen Prozessen beruhe und durch die Evolution in dieser Form hervorgebracht worden sei. Ob und in welcher Form zum Beispiel soziales Verhalten unseren Genen auch schon vorsprachlich evolutionäre Vorteile bringen könnte, wird gerade mal gestreift, wenn Searle auf die soziale Organisation gewisser Tierarten, so der Primaten, hinweist, aber immer sofort betont, dass der Mensch zwar auch ein Tier sei, aber eben das einzige, das eine soziale Wirklichkeit aufzubauen in der Lage ist, in der ein Satz wie „Obama ist der Präsident der USA“ einen Wahrheitsgehalt haben kann. Auch hier eine Petitio Principii, da Searle im Zu-Erklärenden finden will, was er bereits ins Erklärende hineingesteckt hat, und so einen Unterschied findet, wo vielleicht gar keiner ist.
Alles in allem hatte ich mir von einem Text eines der bekanntesten US-amerikanischen Philosophen der Gegenwart mehr erhofft.
John R. Searle: Wie wir die soziale Welt machen. Die Struktur der menschlichen Zivilisationen. Aus dem Amerikanischen von Joachim Schulte. Berlin: Suhrkamp, 2012. (Gelesen in einer Lizenzausgabe der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft aus demselben Jahr.)