Handke und der Nobelpreis für Literatur 2019
Jede Besprechung eines Buchs von Peter Handke muss heute wohl mit einem Schwenker hin zur Verleihung des Nobelpreises für Literatur an diesen Autor beginnen. Insbesondere, wenn sie – wie in meinem Fall – tatsächlich dem Umstand geschuldet ist, dass das Buch nur gelesen wurde, weil seinem Autor dieser Preis verliehen wurde.
Im Vorfeld der Preisverleihung wurden wie jedes Mal Spekulationen geäußert, und Wünsche. Das breite Publikum – so es den Nobelpreis für Literatur überhaupt zur Kenntnis nimmt – hoffte darauf, dass die neue, breiter abgestützte Jury etwas mutiger sein werde. Auf einen Autor aus der Dritten Welt hoffte man. Oder besser noch: auf eine Autorin aus der Dritten Welt. Groß war also die Enttäuschung, als die Preisträger für 2018 und 2019 bekannt gegeben wurden: Wieder Weiße, wieder Europäer. Das Feuilleton aber, die professionelle Literaturkritik, schien zumindest im Fall Handke zufrieden zu sein: Endlich einer, dessen literarische Qualität man seit Jahren feierte! Damit war für einen Moment Ruhe. Dann dämmerte es dem breiten Publikum, wen man da mit Handke wirklich ausgesucht hatte, welche unsäglich dumm-dreisten Aussagen er im Zusammenhang mit den serbisch-bosnischen Auseinandersetzungen beim Zerfall von Titos Jugoslawien wirklich getätigt hatte – Aussagen, die bis zur Leugnung des Völkermords an den Bosniern gingen; Aussagen, die Handke meines Wissens bis heute nicht bereut oder gar widerrufen hat. Nun erst, nach dem Umschwung der Stimmung in der ‚breiten Bevölkerung‘ – so wollte es mir zumindest scheinen – kippte auch der Tenor der Literaturkritik in ein praktisch einstimmiges Falsett. Nachdem die Kritiker jahrelang, immer und immer wieder, bei praktisch jeder Verleihung des Nobelpreises für Literatur, über die mangelnde literarische Qualität des Preisträgers oder der Preisträgerin geklagt hatten, stellten sie plötzlich jenen Satz aus Nobels Testament in den Mittelpunkt, der ihnen jahrelang so ziemlich egal war, den nämlich, in dem Alfred Nobel die Verleihung des Preises an eine Person forderte, die har produceradt det utmärktaste i idealisk rigtning [in der Literatur das Herausragendste in idealistischer Richtung produziert hat]. Ein Satz, der eine eventuelle literarische Qualität der Arbeiten des Preisträgers oder der Preisträgerin in keiner Weise verlangt, und der nun plötzlich wichtig sein sollte.
Dass ein Autorenkollege wie Saša Stanišic auf dem Kurznachrichtendienst Twitter aus allen Rohren gegen Handke schießt, ist verständlich. Immerhin ist, was für Handke etwas rein Abstraktes und deshalb problemlos Abstreitbares ist – nämlich der serbische Genozid an den Bosniern – für Saša Stanišic existenzielle, lebensbedrohende Erfahrung gewesen. Diese direkte Betroffenheit geht aber dem Feuilleton meist ab. Dennoch versuchte nun jeder Literaturkritiker noch seinen eigenen, originellen Senf dazu zu geben. Nur so kann ich es mir erklären, dass nun solche seltsamen Ideen aufkamen wie, dass die Jury zumindest – um die Verleihung an einen Genozid-Leugner zu kompensieren – für 2018 an Stelle von Olga Tokarczuk (über deren Werk zumindest das deutschsprachige Feuilleton bedeutend weniger Worte verlor) eine Person hätte aussuchen sollen, die unter dem jugoslawischen bzw. serbischen Regime gelitten habe, wie z.B. Bora Ćosić. Ohne abstreiten zu wollen, dass Bora Ćosić jederzeit und ebenso gut wie Handke die Qualitäten für eine Verleihung des Literaturnobelpreises aufweist: Diese Idee einer Kompensation ist schon im Bereiche des Umweltschutzes, also beim CO2, hanebüchen und dient allenfalls der Beruhigung des schlechten Gewissens bei Klein-Maxi.
Mir will scheinen, dass der ‚Fall Handke‘ in ebenso großem Masse ein ‚Fall Literaturkritik‘ ist. Sollen wir so weit gehen wie Lukas Bärfuss und eine Änderung dessen verlangen, was wir als ‚literarische Qualität‘ verstehen, in die Definition dieser Qualität immer auch die politischen Anschauungen des Autors bzw. der Autorin einbeziehen? Gibt es tatsächlich ein vom Autor und dessen Ansichten unabhängig Festmachbares wie literarische Qualität nicht? So verlockend Bärfuss‘ Idee auf den ersten Blick scheint: Öffnet sie nicht einer Denunziation von links wie rechts Tür und Tor? Vielleicht aber ist die Idee einer vom Autor unabhängigen literarischen Qualität tatsächlich eine Idee des Bildungsbürgers aus dem 19. Jahrhundert und sollte langsam fallen gelassen werden? Nur: Was wollen wir an dessen Stelle setzen? Ich weiss es nicht.
Die morawische Nacht
Natürlich kannte ich die ‚klassischen‘ Werke Handkes – die Werke, mit denen er den 68ern das Gefühl vermittelte, irgendwie einer der ihren zu sein, die Sinnlosigkeit und Entwürdigung des menschlichen Lebens anzuprangern: die Publikumsbeschimpfung, Die Angst des Tormanns beim Elfmeter, Der kurze Brief zum langen Abschied, Wunschloses Unglück – alle schon im Titel knackig und prägnant. Dann kam die Zeit, als ich anderes zu tun hatte, als mich um die Neuerscheinungen der Lieblinge des Feuilletons zu kümmern, und ich verlor nicht nur Handke aus den Augen. (Nur ganz nebenbei bekam ich seine ‚Radikalisierung‘ mit.) Erst im 21. Jahrhundert konnte ich hin und wieder einen Blick ins Feuilleton werfen – ohne allerdings bei irgendeinem der alten oder auch neuen Lieblinge wirklich das Bedürfnis zu verspüren, etwas von ihnen lesen zu müssen oder auch nur zu wollen. Von Zeit zu Zeit tat ich es dennoch – meist habe ich es bereut.
Als nun aber die Verleihung des Nobelpreises für Literatur an Handke bekannt wurde und der Rummel um seine politische Position immer lauter wurde, wollte ich doch einmal etwas von dem lesen, was dem Feuilleton so gut gefallen hatte, als es noch problemlos literarische Qualität des Werks und politische Haltung des Autors trennen durfte. Mir Die morawische Nacht zu beschaffen, war auch ebenso problemlos möglich: Selbst ein paar Tage nach der Bekanntgabe der Preisträger konnte ich das Taschenbuch im Internet kaufen, als praktisch alle andern Titel für den Moment nicht mehr lieferbar waren. Nach wenigen Tagen lag es bei mir: suhrkamp taschenbuch 4108 in der ersten Auflage von 2009 (die gebundene Ausgabe erschien ein Jahr früher). Schon dies zeigt, wie sehr sich die Ansichten des Feuilletons darüber, was lesenswert ist, unterscheiden von der des ‚breiten Lesepublikums‘.
Auf dem hinteren Buchdeckel finden wir Ausschnitte aus zwei enthusiastischen Besprechungen der Süddeutschen Zeitung bzw. der NZZ. Von einer Erzählung einer rigorosen Selbstprüfung ist da die Rede, von Handkes majestätischen Andersheit und einer große[n] Frische. Offen gestanden kann ich wenig davon finden.
Gewiss: Handke kann schreiben. Immer wieder gibt es in diesem Buch Szenen, in denen es ihm – offenbar mühelos – gelingt, die Erzählzeit Harmonika-artig auseinander zu ziehen oder zusammen zu falten. Auf diese Weise kann er eine träumerische, unwirkliche Stimmung kreieren, dies sich durch die ganze Geschichte zieht. Damit aber hat es sich schon. Das Ganze stellt eine Reise dar eines ehemaligen Autors durch Europa, die in Morawien beginnt und dort auch wieder endet – wobei dieses Morawien hier offenbar nicht die heute tschechische Landschaft Mähren meint, sondern irgendwo im Balkan liegt, wie Handke jene Gegend nennt, die gerade erst von einem Krieg durchzogen worden ist – im ehemaligen Jugoslawien also. Doch der Krieg spielt nur eine kleine Nebenrolle. In einer langen Nacht wird diese Reise des Protagonisten in einem kleinen Kreis von dessen Freunden ausgebreitet. Das Problem dieser 560 Seiten langen Erzählung ist, dass Handke zwar über einen ausgefeilten Stil verfügt, über eine geniale Erzähltechnik – aber nichts zu erzählen hat. Die Figuren bleiben mehr als blass. Zu keiner Zeit interessiert den Leser auch nur eine davon – und schon gar nicht der Protagonist, der ehemalige Autor. Das Buch ist esoterisch in dem Sinn, dass nur ein kleiner Kreis Eingeweihter, nämlich die professionelle Literaturkritik, an Handkes Luftschlössern Gefallen findet, weil nur diese – dem an ’normaler Speise‘ sich überfressen habenden Gourmet gleich, der immer ausgefallenere Gewürze benötigt, um seinen Gaumen kitzeln zu können – weil nur diese also an Handkes literarischer Selbstbeweihräucherung teilhaben kann und will. Handke ist im Grunde genommen ein literarischer Onanist – und mit ihm hat sich (jedenfalls bis vor kurzem) auch das Feuilleton bei jeder seiner Neuerscheinungen ins Höschen gemacht.
Empfehlenswert allenfalls für Leute, die viel Zeit haben, um 560 Seiten Nullität zu lesen. Oder die für solche Lektüre bezahlt werden. Ich für meinen Teil stehe der Morawischen Nacht gespalten gegenüber. Der Teil von mir, der die professionelle Ausbildung der Literaturkritiker ebenfalls erhalten hat, applaudiert der verwendeten Erzähltechnik. Der Teil, der nicht als Profi liest, kann mit dem Buch wenig anfangen, ja ist bei dessen Lektüre immer wieder eingeschlafen. Zumindest hätte dem Text eine radikale Kürzung (sagen wir: um 500 Seiten) gut getan.

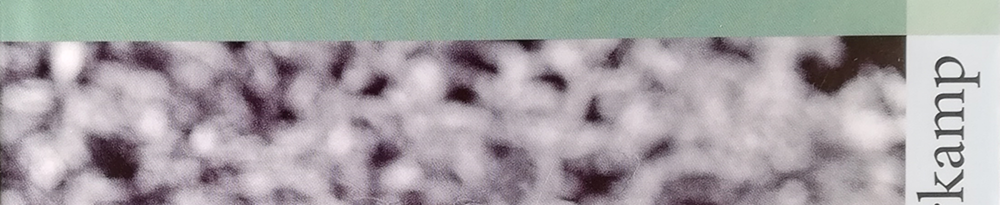
1 Reply to “Peter Handke: Die morawische Nacht”