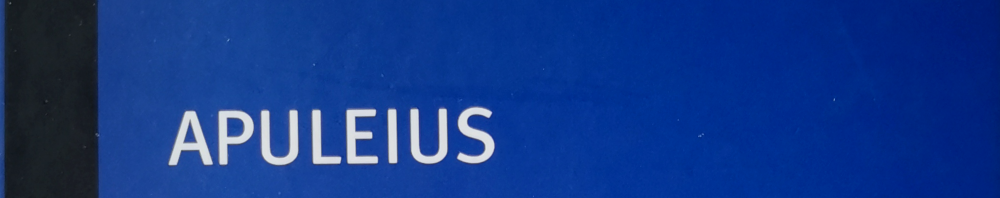Apuleius ist so etwas wie der Paradiesvogel unter den antiken Autoren. Er hat sich literarisch wie philosophisch betätigt und galt schon den beiden Kirchenvätern Laktanz und Augustin als Magier, der zu bekämpfen bzw. zu widerlegen war. Ein Ruf, den er sich wohl auch ein wenig selber eingebrockt hat, nicht zuletzt wegen der vorliegenden Schrift Über die Magie, obwohl es darin nur ganz am Rande um Magie geht. Aber um die Schrift und Apuleius besser zu verstehen, müssen wir jetzt etwas machen, das ich im Normalfall nur ungern tue – wir müssen uns vor dem Text kurz die Biografie des Apuleius anschauen. Aber Paradiesvögel sind auch keine Normalfälle.
Nun denn:
Das Leben des Apuleius
Apuleius kam im Jahr 123 u.Z. in einer der römischen Provinzen in Afrika zur Welt. Sein Vater war einer der führenden Politiker seiner Heimatstadt. Apuleius und sein Bruder erbten nach seinem Tod rund zwei Millionen Sesterzen – die Familie war also nicht ganz mittellos. Unser Autor nun verwendete sein Erbe vorwiegend dafür, im Römischen Reich von Stadt zu Stadt zu reisen, und Halt zu machen, wo immer er eine philosophische Schule fand, bei deren Oberhaupt er hören konnte. Unter anderem hielt er sich so auch eine Zeitlang in Athen auf, und in Rom selber. Neben der Philosophie ließ er sich fleißig in alle Mysterien einführen, die ihn irgendwie einführen wollten. Einen Brotberuf scheint er dabei keinen ausgeübt zu haben. Irgendwann finden wir ihn dann in Oea, dem heutigen Tripolis. Dort hatte er offenbar eine wohlhabende Frau geheiratet, die – seit einiger Zeit Witwe und ein paar Jahre älter als Apuleius – mit dieser Ehe in ihrer Familie etwelche Zwietracht säte. Apuleius‘ Spur verliert sich später in Karthago, wo er offenbar leitender Priester im Kaiserkult der Provinz Africa proconsularis geworden war. Wann und in welchen Umständen er gestorben ist, wissen wir nicht.
Der vorliegende Text
Über die Magie handelt praktisch gar nicht von der Magie. Es handelt sich bei diesem Text um eine Verteidigungsrede, die Apuleius in eigener Sache vor Gericht gehalten hat. (Das heißt: Ob wir hier eine stenografische Mitschrift der tatsächlichen Rede vor uns haben, oder den Rede-Entwurf des Apuleius, oder – am wahrscheinlichsten – einen nachträglich noch zurecht gemachten Text (was durchaus der rhetorischen Praxis der Zeit entsprach, selbst Cicero feilte seine Reden noch einmal um, nachdem er sie bereits gehalten hatte – die schriftlichen Exemplare sollten ja nicht historisches Zeugnis sein, sondern als rhetorisches Exempel dienen) können wir heute nicht mehr sagen.) Denn einer der Söhne der ehemaligen Witwe, unterstützt von seinem Onkel (dem Bruder also des verstorbenen ersten Mannes), hatte gegen Apuleius geklagt, er habe seine Mutter mit Magie bezirzt und nur so herumgekriegt und auch nur geheiratet um ihres Geldes willen. Die Stoßrichtung der Anklage war offensichtlich. Apuleius aber nutzt seine Verteidigungsrede, um einerseits ein Exempel einer rhetorisch gelungenen solchen Rede zu statuieren, und andererseits, um sich als Philosophen und sein Leben als philosophisch zu qualifizieren.
Dabei situiert sich der Angeklagte als Platoniker, und erklärt seine Taten, für die er angeklagt ist, als philosophische Untersuchungen. Die seltenen Fische, die er gesucht und dann seziert hat, hat er im Interesse naturwissenschaftlicher Forschung gesucht und seziert. Hier beruft er sich auf Aristoteles, aber das war zu der Zeit Usus, dass man Aristoteles und seine Schule für den Platonismus reklamierte. (Eher seltsam mutet da schon der Umstand an, dass Apuleius ein Exempel einer Verteidigungsrede streng nach allen Regeln der sophistischen Rhetorik zu liefern im Stande ist – angesichts des Umstands, dass Platon selber die Redekunst so ziemlich in Grund und Boden verdammt hatte.) Dass da schon mal die eine oder die andere Person in seiner (Apuleius‘) Gegenwart umgefallen ist, führt er darauf zurück, dass sein platonisch-medizinisches Interessen ihn dazu führte, diese Epileptiker untersuchen zu wollen. Liest man seinen Text genau, wird man zwar nicht ganz sicher sein, ob da nicht doch ein Versuch stattgefunden hat, in neupythagoreischem Sinn den Dämon zu exorzieren, von dem die Antike eine an Epilepsie leidende Person besessen glaubte.
Apuleius wurde offenbar frei gesprochen. Anders lässt sich nicht erklären, dass er später als Oberpriester zu amten im Stande war. Es war wohl auch so, dass die doch relativ provinziellen Ankläger die Eloquenz des weit herum gekommenen und hoch gebildeten Fremden unterschätzt hatten – während der Richter, ähnlich gebildet wie der Angeklagte, sie offenbar zu schätzen wusste.
Die vorliegende Ausgabe
Vor mir liegt der Text des Apuleius in folgender Ausgabe:
Apuleius: De magia. Lateinisch – deutsch. Eingeleitet, übersetzt und mit interpretierenden Essays versehen von Jürgen Hammerstaedt, Peter Habermehl, Francesca Lamberti, Adolf M. Ritter und Peter Schenk. (= Band V der Reihe SAPERE (Scripta Antiquitatis Posterioris ad Ethicam REligionemque pertinentia – Schriften der späteren Antike zu ethischen und religiösen Fragen)) Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2002
Zur Übersetzung kann ich wenig sagen. Das eine oder andere Mal, wie ich aufs lateinische Original geschielt habe, schien sie mir jedenfalls korrekt, aber ich bin kein Altphilologe.
Die Essays insgesamt sind sehr erhellend. Die biografischen, indem sie uns einen Blick erlauben auf eine Figur, die zwar schillernd war, aber doch immer Philosophie, Juristerei und Medizin, und leider auch Theologie durchaus studiert hat, mit heißem Bemüh’n. Wir erhaschen dank der in den Essays und den Anmerkungen zu findenden Informationen auch einen guten Blick auf den Alltag und das Leben in einer etwas weiter von den großen Zentren Rom und Athen entfernten Orten des Römischen Reichs im zweiten nachchristlichen Jahrhundert – in einer Provinz, die genau das war, was wir heute meinen, wenn wir dieses Wort verwenden. Ein rechtsgeschichtlicher Essay klärt auf über das geltende Recht und seine Anwendung in Rom – die beide von der heutigen Praxis weit entfernt sind. Selbst der Aufsatz Über die Magie im frühen Christentum, der, wie sein Autor Ritter selber zugibt, wenig mit dem Text zu tun hat, weist doch auf die Rezeption Apuleius‘ im Ganzen hin, die er im Christentum erlitten hat, und die in ihren Grundzügen bereits von seinen beiden afrikanischen Landsleuten Laktanz und Augustinus von Hippo determiniert wurde.
Alles in allem also recht interessant – eigentlicher Text wie Beilagen. Leider scheint die Reihe SAPERE bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft eingestellt zu sein und nur noch der ebenfalls von Apuleius stammende Text Über den Gott des Sokrates (Apuleius meinte natürlich den Dämon, von dem Sokrates behauptete, dass alle seine Handlungen nach dessen Eingebungen erfolgt oder nicht erfolgt seien) ist aktuell noch als Print on Demand erhältlich.