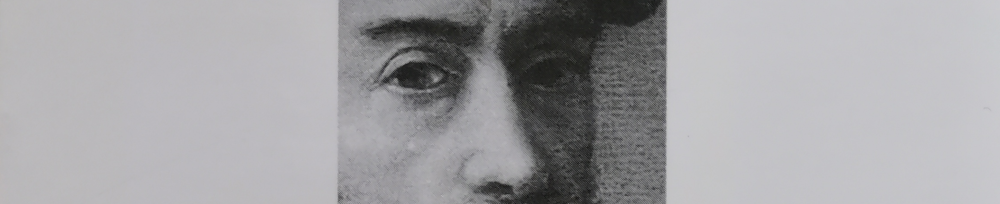Mehr als zehn Jahre nach dem Band Gargantua erschien 1546 Le tiers livre, das dritte Buch der Abenteuer von Gargantua und Pantagruel. Was Rabelais in den Jahren zwischen 1533/35 und 1546 genau gemacht hat, wissen wir nicht. Wir wissen also auch nicht, warum er nach so langer Zeit noch einen weiteren Band von und über Pantagruel herausbrachte. Was wir wissen und sehen, ist aber der Unterschied, den die zehn Jahre in Rabelais‘ Schreiben hervorgebracht haben. Le tiers livre unterscheidet sich in diversen Punkten signifikant von seinen beiden Vorgängern.
Das lässt sich schon an Hand des Titels erkennen:
Le tiers livre des faicts et dicts heroïques du bon Pantagruel : composés par M. François Rabelais, Docteur en Médecine, et Calloier des Iles d’Hyeres.
Anders als bei seinen beiden Vorgängern, die Rabelais unter einem Akronym als Autorennamen erscheinen ließ, steht also nun sein richtiger Name auf dem Titelblatt. Vielleicht war Rabelais dieses Mal mutiger, weil er ein königliches Privileg vorweisen bzw. vor dem eigentlichen Text drucken konnte? Die Sorbonne hinderte das nicht daran, das Buch trotzdem zu verbieten. Was den König offenbar wiederum nicht daran hinderte, bei der dritten Auflage sein Privileg zu erneuern, obwohl zu dem Zeitpunkt das Verbot der Sorbonne bereits ausgesprochen war. Im Übrigen spricht der Autor nur im Vorwort in der Ich-Form, anders als sein Akronym, das auch im Text aufgetreten ist. Er vergleicht sich hier – der Vergleich stammt aus Lukian – mit Diogenes, dem antiken kynischen Philosophen und verspricht auch, nach getaner Arbeit in sein Fass zurück zu kehren.
Ein anderer Unterschied ist aber noch wichtiger – ein Unterschied, der sich auch im Text bemerkbar macht. Wurde im Buch Pantagruel der Titelheld noch in seinen faictz & prouesses espouentables, also seinen Handlungen und erstaunlichen Heldentaten, vorgestellt, finden wir hier zwar immer noch die faicts, also Handlungen, diesmal aber kombiniert nicht mit erstaunlichen Heldentaten, sondern mit dicts heroïques, heldenhaften Worten. Tatsächlich ist dann auch im Text jeder Anklang an die Ritterromane, über die sich die ersten beiden Bücher um Gargantua und Pantagruel lustig machten, verschwunden. Selbst als roy des Dipsodes, König der krankhaften Säufer (bei Rabelais ein ganzes Volk, das soeben mit den Utopiern Krieg geführt hat), wird er nicht mehr dargestellt – weder im Titel noch im Text. Zu Beginn des Textes erfahren wir noch, dass Pantagruel, als nach seinem Sieg über die Dipsodes deren Land offenbar praktisch entvölkert war, nicht weniger als 9’876’543’210′ Männer aus Utopien in sein neues Land verpflanzt – Frauen und Kinder explizit nicht mitgezählt. Dies ist seine letzte königliche Tat – es wird im weiteren Verlauf der Geschichte nie mehr der König der Dipsodes erwähnt werden. Dass er so viele Männer verschicken kann, führt der Erzähler auf die ungeheure Fruchtbarkeit der Utopierinnen zurück, die im Schnitt nicht weniger als sieben Kinder aufs Mal gebären. (Finden wir hier eine freundschaftliche Spitze gegen Thomas Morus und sein Utopia, das ja auch Kriege führt und Kolonien gründet?)
Keine Handlungen also, sondern Worte. Denn nun treten an Stelle der Erzählungen von Schlachten und Heldentaten tatsächlich die von Wortgefechten. Ähnlich wie es sein Vater mit Frère Jean machte, hat auch Pantagruel seinen besten Helfer im Krieg gegen die Dipsodes als Gutsherren im Land der nunmehr Besiegten installiert. Anders aber als Frère Jean gründet Panurge, um den handelt es sich nämlich, keine Abtei, keine Akademie – überhaupt nichts, was die Welt irgendwie besser machen würde. Er lenkte nämlich die Geschicke seines Guts so gut und so vorsichtig (wie es der Erzähler ironisch formuliert), dass er binnen weniger als vierzehn Tagen das ganze sichere Einkommen seines Gutes für die nächsten drei Jahre ausgegeben hatte – und das unsichere Einkommen derselben Zeit dazu. Es gibt nun nur noch ein Hilfsmittel: eine reiche Heirat. Und so verbringen wir bald den Rest des Romans damit, Panurge zuzuschauen, wie er auf verschiedenste Art und Weise herauszubringen versucht, ob er überhaupt heiraten soll, oder ob er damit nur Gefahr laufe, von seiner Frau Hörner aufgesetzt zu kriegen, und es also lassen soll. (Ja, Le tiers livre ist ausgesprochen misogyn.) Panurge, der nun zur wichtigsten Person der Erzählung aufgestiegen ist, befragt verschiedene Orakel, und als ihn das nicht weiter bringt, auch Theologen, Mediziner, Juristen und Philosophen. Meist im Gespräch mit Pantagruel, manchmal auch mit anderen, versucht Panurge dann, die Aussagen der verschiedenen Orakel und Menschen zu deuten. Bei der Diskussion der Orakel steht Rabelais, so der Konsens der Forschung, bei seinem Freund Erasmus und dessen Vertrauten Gesprächen in einiger Schuld. Noch jedes Mal, wenn sein Gesprächspartner die Aussagen eines Orakels dahingehend deutet, dass Panurge doch heiraten soll, findet der Kasuist Panurge eine Interpretation, die genau das Gegenteil aussagt. Wenn Homer zitiert, oder eine Stelle im Vergil durch Bücherstechen hervorgebracht wird, ist das noch harmlos. Wenn aber Panurge dasselbe tut bei den Bibelstellen, die ihm der Theologe zitiert (womit der Autor auf den vierfachen Schriftsinn anspielt, mit dessen Hilfe die Theologie seit Alters auch völlig areligiöse, ja anstößige Stellen für den Glauben gerettet hat), dann gerät natürlich nicht nur sein Protagonist in Konflikt mit dogmatisch-konservativ ausgerichteten Kirchenkreise, sondern auch der Autor selber. Kein Wunder, hat die Sorbonne das Buch verboten. Dass die Medizin Symptome genau so unglaubwürdig interpretierte und darin bloßgestellt wurde, konnte sie aber wohl verschmerzen. Der Jurist und Richter seinerseits erwürfelt gleich von Beginn weg seine Urteile; und der Philosoph argumentiert gleich von Anfang an skeptizistisch und beantwortet die an ihn gestellten Fragen durchs Band mit „sowohl – als auch“, „vielleicht ja, vielleicht nein“.
Kommen wir zu den Titelhelden zurück, denn auch sonst hat sich der Charakter von Gargantua und Pantagruel im tiers livre geändert. Sie sind nicht mehr die fress- und saufwütigen Raufbolde der ersten beiden Bücher. Schon im Titel vom dritten Buch fällt auf, dass Pantagruel nun bon genannt wird, gut. Und das ist durchaus in ethisch-moralischem Sinn gemeint. Beide, Gargantua (der im tiers livre wieder erscheint, obwohl er im Buch Pantagruel ins Reich der Feen gewandert sein soll) und Pantagruel, werden als gute Monarchen im Kreis ihrer Freunde dargestellt. Auch Riesen scheinen sie keine mehr zu sein; jedenfalls wird ihre Körpergröße nirgends mehr erwähnt. Aber wir treffen Gargantua beim Unterzeichnen von Erlassen und auch wenn Pantagruel nicht als Herrscher vorgestellt wird, suggeriert doch seine Rolle unter seinen Freunden den König. Und auch er gibt sich leutselig und ist sehr intelligent.
Zum Abschluss des Romans beschließt Panurge, la Dive Bouteille, das Orakel der göttlichen Flasche, zu konsultieren und macht sich auf den Weg übers Meer. Allerdings kommt er tiers livre nicht über erste Vorbereitungen zu Reise hinaus, denn der Autor beendet den Roman mit einer Art Cliffhanger und unterbricht seine Erzählung mit einer Lobrede auf die Pflanze pantagruélion, gemeint ist der Hanf. Es geht Rabelais dabei darum, deren verschiedenste Verwendungsmöglichkeiten zu loben – ans Rauchen dachte zu seiner Zeit noch kein Mensch.
Fazit: Le tiers lievre ist ganz anders als die ersten beiden Bücher der Saga um Gargantua und Pantagruel, aber nicht weniger interessant und witzig. Allerdings in seiner Satire zeitgebundener als die dortigen, überzeitlichen Motive des Riesen unter den Menschen.