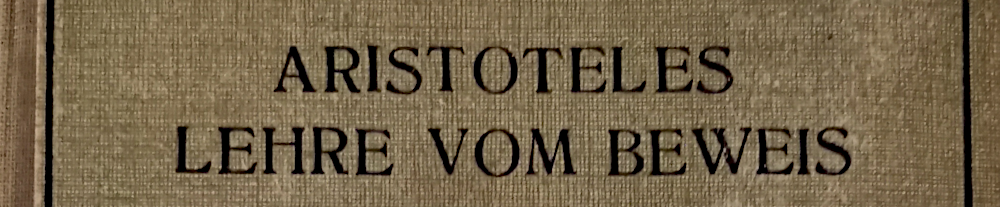Die Lehre vom Beweis wurde seinerzeit als vierter Band in die Sammlung logischer Schriften eingefügt, die heute als das Organon des Aristoteles bekannt ist. Dass diese Schriften von einander unabhängig entstanden sind, zeigt sich auch in diesem Text. Vieles von dem, was in der Lehre vom Schluss, dem dritten Buch des Organon gesagt wurde, wird hier mehr oder weniger identisch wiederholt. Es findet sich allerdings auch ein interner Verweis vom vierten aufs dritte Buch, was bedeutet, dass Aristoteles beide Schriften als ‚gültig‘ betrachtete. Vielleicht waren die Texte ursprünglich zum einen für eine Veranstaltung mit Anfängern (Lehre vom Schluss) bzw. für Fortgeschrittene (dieser Text hier) gedacht, denn tatsächlich geht Aristoteles hier ein wenig mehr in die Tiefe und ein wenig in eine andere Richtung als im der Lehre vom Schluss).
Beide Bücher aber stellen weniger logische Schriften, denn Anleitungen zum (natur-)wissenschaftlichen Arbeiten dar. Aristoteles‘ Ausgangsfrage ist in beiden Schriften dieselbe: Wenn ich sehe, dass Phänomen A immer zu Phänomen B führt und B immer zu C: Kann ich dann als Wissenschaftler einen sicheren Schluss ziehen dahingenden, dass auch A immer C impliziert, selbst wenn das nicht beobachtbar ist? Im vierten Teil des Organon hier kompliziert Aristoteles seine Frage, indem er im klassischen dreiteiligen Schlussverfahren die Glieder auszutauschen beginnt. Was, fragt er zum Beispiel, wenn ich nur das mittlere Glied habe? Was kann ich dann aussagen?
Zwei Dinge finde ich auch heute noch bemerkenswert in der Lehre vom Beweis. Da ist der Umstand, dass Aristoteles nicht nur behauptet, sondern logisch bewiesen zu haben glaubt, dass solche Ketten wie ‚es ist A; wenn A, dann immer B; wenn B, dann immer C; wenn C, etc. etc.‘ nicht in infinitum gebaut werden können. Beide Enden, um es so zu sagen, sind nicht offen, sondern geschlossen. Ein Schluss hat einen fixen Anfang und ein fixes Ende. Hier finden wir bereits die logischen Anfänge jenes Phänomen, das bei Plotin schließlich zu einem Grund alles Seins führte, der selber keinen Grund mehr hat, vielmehr alles aus sich selber fließen lässt – ein Gedanke, den die Kirchenväter übernommen und der christlichen Theologie angepasst haben.
Das andere Bemerkenswerte ist, dass Aristoteles, wenn er die Schlusskette in der Mitte anfasst, statt am Anfang (bzw. die Mitte zu einem neuen Anfang macht), die drei Glieder aber so weit wie möglich identisch lässt, feststellen muss, dass mit der Änderung der Fragestellung unter Umständen schon rein logisch eine geänderte Antwort resultiert. Das erinnert an den Streit zwischen Lavoisier und Boyle in der Frage „Sauerstoff oder Phlogiston?“, die zu einem der paradigmatischen Anschauungsbeispielen der Wissenschaftstheorie der wissenschaftlichen Revolutionen zählt. Wir haben hier sozusagen den aristotelischen Kern des Kuhn’schen Paradigmen-Pudels vor uns.
Fazit: Zumindest für die Geschichte der Wissenschaftstheorie und der Philosophie lernt man noch immer vom Organon des Aristoteles.