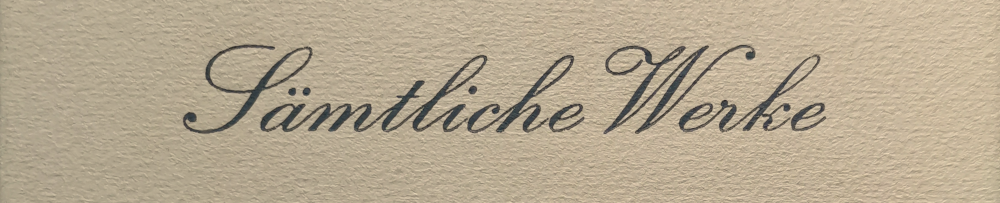Raimund gilt, zusammen mit dem etwas jüngeren Nestroy, als der Vollender der so genannten „Wiener Zauberposse“ (oder, vornehmer ausgedrückt, des „Alt-Wiener Volkstheaters“). Ja, heute ist es sogar so, dass dem breiten Publikum (zu dem ich mich hier auch zähle) eigentlich nur noch diese beiden bekannt sind. Alles, was vor- und nachher war, ist dem Vergessen anheim gefallen, bzw. bildet noch Material für eine spezialisierte Literaturgeschichte. Entstanden ist das „Alt-Wiener Volkstheater“ aus den Hanswurstiaden des Barock, heimisch war es in den Bühnen der Wiener Vorstädte, dem Theater in der Leopoldstadt und dem in der Josefstadt.
Raimund wollte mehr sein als nur ein Possenreißer, er sah sich als echten Dichter. Wie nach ihm auch Nestroy mischte er in seinen Stücken Wiener Dialekt und Hochsprache, wie nach ihm auch Nestroy verwendete er seine Texte, um die Zensur des Vormärz, der Metternich’schen Restauration in Österreich, auszutricksen – was ihm, vielleicht, weil er ein bisschen weniger bissig war als Nestroy, auch besser gelang als diesem: Raimund kannte kaum Probleme mit der Zensur.
Der Barometermacher auf der Zauberinsel ist Raimunds erstes Stück. Gedacht für eine Benefizvorstellung für den Schauspieler Raimund, sollte es ursprünglich von einem anderen geschrieben werden, aber Raimund war mit dem ersten Akt von Karl Meisl (s.o.: „spezialisierte Literaturgeschichte“ …) so unzufrieden, dass er ihm den Auftrag entzog und das Stück selber verfasste.
Die Handlung spielt als eine Art Märchen auf einer unbestimmten, fernen Insel. Dort haust die Fee Rosalinde, die alle hundert Jahre drei Zaubergaben (Stab, Horn und Schärpe) einem Sterblichen verleihen muss. Diesmal trifft es einen als Schiffbrüchigen auf der Insel angeschwemmten ehemaligen Barometermacher. Der ist auf Grund der schlechten Qualität seiner Ware in seinem bürgerlichen Beruf gescheitert und ergreift die Möglichkeit, sich mit den Zaubergaben wieder respektabel zu machen, natürlich mit großer Begier. Er ist aber leider zwar ein freundlicher und liebenswürdiger Geselle, aber nicht der hellste. So kommt es, dass der (menschliche) Herrscher der Insel, Tutu, bzw. seine zank- und habsüchtige Tochter Zoraide ihm alle drei Gaben entwenden können. Erst, als er einen Feigenbaum findet, dessen Früchte den Menschen lange Nasen wachsen lassen und daneben eine Quelle, deren Wasser die Nasen wieder aufs Normalmaß zurückgehen lässt, kann er sie sich erneut aneignen und nunmehr mit dem Stubenmädchen der königlichen Herrschaften ein glückliches Leben führen.
Natürlich hat die Geschichte einige logische Löcher. Zum Beispiel wird nicht klar (weil gar nicht erklärt), warum denn nun die Fee Rosalinde alle hundert Jahre ihre Zaubergaben einem Sterblichen in die Finger drücken muss. Genau so wenig wird erklärt, wie lange denn so ein Mensch diese Zauberdinge behalten darf. Jedenfalls hält sich Bartholomäus Quecksilber, der Barometermacher, einige Zeit auf der Insel auf, ohne dass die Gaben zurück gefordert würden. Ganz zum Schluss spielen sie einfach keine Rolle mehr. Barometermacher wie Autor scheinen auf sie (um bei einem Wiener Stück einmal einen Austriazismus zu verwenden) vergessen zu haben. Auch die Fee tritt nur am Anfang auf und lässt im Folgenden dann den Bartholomäus einen guten Mann sein.
Auf der Suche nach den literarischen Quellen dieser Zauberposse finden wir uns im Weimar der deutschen Klassik wieder. Ursprünglich eine französische ‚conte de fées‘ aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, wurde sie von Friedrich Hildebrand von Einsiedel bearbeitet und erschien auf Deutsch in einem Sammelwerk Dschinnistan von Christoph Martin Wieland (der selber ja auch solche Märchen bearbeitet hatte). Die Gebrüder Grimm fügten den ersten Teil der Geschichte ihrer Märchensammlung hinzu und versuchten, Spuren davon schon bei Hans Sachs aufzufinden. Eine weitere Version, um den Reigen berühmter Bearbeiter abzuschließen, erschien in der von Heinrich von Kleist herausgegebenen Zeitschrift Phoenix. Eine durchaus respektable Ahnengalerie also.
Raimund seinerseits konzentrierte sich in diesem Märchen vor allem auf die Ereignisse am Hof des Königs Tutu. Die sich dort abspielenden Intrigen und vor allem der König selber, der nur aufs Schlafen und Essen versessen ist, zeichneten den Zeitgenossen ein leicht erkennbares Bild des Wiener Kaiserhofs unter Franz I., der sich notorisch mehr für Pflanzenkunde als für Politik interessierte und Metternich so ziemlich machen liess.
Fazit: Ein wenig schade ist es ja schon, dass Raimund heute hinter dem bissigeren Nestroy zurück treten muss – sofern einer der beiden heute überhaupt noch aufgeführt wird. Das vorliegende Stück lebt eindeutig vom Spektakel, das bei einer Aufführung daraus gemacht werden kann und muss. Für Lesende ist es zwar ganz witzig, aber der letzte Schmiss fehlt halt.
Gelesen in folgender Ausgabe:
Ferdinand Raimund: Sämtliche Werke. Herausgegeben von Friedrich Schreyvogl. München: Winkler, 1966. [Ursprünglich 1960]