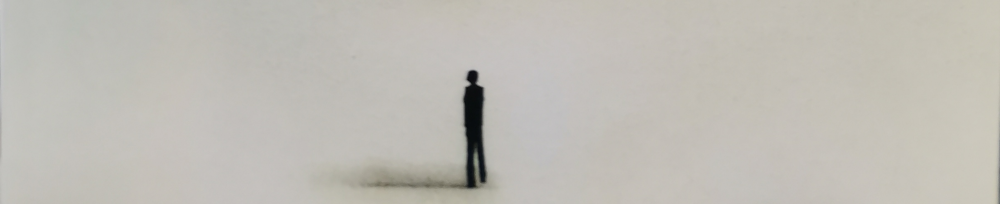Kurz nach der Befreiung Frankreichs wurde in Paris ein Club gegründet mit dem Namen Maintenant („Jetzt“). Am 29. Oktober 1945 – der Zweite Weltkrieg war also gar noch nicht so lange her – hielt Jean-Paul Sartre dort eine Lesung zum Thema: L’existentialisme est-il un humanisme? („Ist der Existenzialismus humanistisch?“ – wir können im Deutschen eigentlich nicht von einem Humanismus reden, aber dazu gleich). Der Vortrag und die anschließende Diskussion wurden mitstenographiert und im folgenden Jahr veröffentlicht. Sartre sollte Vortrag wie Veröffentlichung später bereuen. Jedenfalls aber zeigt schon deren Titel der Veröffentlichung, dass Sartre damals, 1945, die Ausgangsfrage positiv beantwortete.
Der nicht sehr umfangreiche Text (110 großzügig gesetzte Seiten in meinem Taschenbuch1)) ist aktuell auf Deutsch vergriffen, wenn ich meinen Suchmaschinen glauben darf. Das ist weiter nicht verwunderlich (auch wenn er noch vor kurzem mit der fürchterlichen direkten Übersetzung Der Existenzialismus ist ein Humanismus greifbar gewesen sein dürfte).
Nicht verwunderlich, denn in der philosophischen Diskussion von Sartres Positionen (bzw. der Diskussion von Sartres philisophischer Position) spielt der Text kaum eine Rolle. Dass er in Frankreich dennoch immer wieder aufgelegt wird, liegt wohl eher als an der Qualität des Textes am Umstand, dass er versucht, die Position Sartres relativ leicht verständlich zu umschreiben. Will sagen: Das Büchlein wird für den Philosophie-Unterricht in der Schule benutzt.
Warum aber spielt denn der Text in der Philosophie kaum eine Rolle? Ganz einfach: Er ist philosophisch betrachtet einfach nur fürchterlich. Sartre argumentiert schlampig, definiert kaum und wenn, dann oft sich widersprechend. Schon das Wort ‚Humanismus‘, das, außerhalb des Textes wie auch innerhalb, in sehr vielen verschiedenen Bedeutungen verwendet wird, kann oder will er nicht sauber definieren. Dasselbe gilt beim Begriff ‚Existenzialismus‘. Sartre gibt zu Beginn des Referats zu, dass der Existenzialismus in verschiedenen Versionen existiert; explizit nennt er eine katholische Variante – die von André Gide. Er wehrt sich dagegen, dass der Existenzialismus auf Angst beruht; nur um dann Kierkegaard ins Spiel für den eigenen Existenzialismus zu bringen – ohne Rücksicht darauf, dass Kierkegaard sich selber nie als Existenzialisten begriffen hat, begreifen konnte. Ansonsten wehrt er sich vor allem dagegen, dass Existenzialist sein gleichbedeutend sei mit Egoist sein. Für einen Husserl-Schüler sind die philosophischen Definitionen des Textes absolut katastrophal.
Vortrag wie Diskussion dienten aber nur sekundär philosophischen Zwecken. Es ging Sartre in der Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg und damit bei diesem Anlass darum, als echter Kommunist betrachtet zu werden und in die französische kommunistische Partei aufgenommen zu werden. Diese wiederum lehnte den Existenzialismus ab, weil der ihrer Ansicht nach dem Individualismus huldigte und nicht dem Kollektiv. Mit der Bejahung der Frage nach dem Humanismus des Existenzialismus versuchte Sartre vor allem, nachzuweisen, dass auch das existenzialistische Denken (zumindest, wenn es à la Sartre war) ‚humanistisch‘ sein könne – im Sinne dessen, dass die Humanität, die Menschheit, betrachtet werde und für deren Gutes gearbeitet. Dumm nur, dass sich Sartre derart verbiegt, dass kaum klar aus seinem Referat heraus gelesen werden kann. Ich will versuchen, Sartres Hauptargument, weshalb der Existenzialismus humanistisch sei, zusammen zu fassen. Das Axiom dieses Vortrags, „Die Existenz geht dem Wesen voraus“, wird normalerweise mit der Vorstellung erklärt, dass es, wenn Gott nicht existiert, „keine menschliche Natur gibt“. Dieses wiederum wird von den Marxisten ebenso bestritten wie von Sartre. Die essentialistische Sichtweise vergisst, so Sartre, die Historizität des Menschen zu berücksichtigen. Nach Sartre ist der Mensch frei, zu werden, was er will. Der Mensch ist in der Tat nichts anderes als das, was er sich selbst macht, indem er sich durch seine Verpflichtungen und Handlungen definiert. Wir sehen: So ganz kriegt Sartre den den Kommunisten verdächtigen Individualismus nicht aus seinem Existenzialismus heraus, auch wenn ihn natürlich die Verpflichtungen und Handlungen hätten retten sollen. Die anschließende Diskussion machte das Ganze nicht besser, im Gegenteil. Nach ein paar relativ harmlosen Fragen aus dem Publikum, erhob sich schließlich Pierre Naville – ehemaliger Surrealist, nachmaliges Mitglied der Kommunistischen Partei Frankreichs, ausgeschlossen wegen Trotzkismus, später aber wieder eingetreten. Bei seiner Entgegnung handelt es sich im Grunde genommen um ein eigenes Referat. Sie hat denn auch relativ wenig mit Sartres Vortrag zu tun sondern listet einfach noch einmal die Vorwürfe der kommunistischen Partei an Sartre auf – ohne dass dieser (nur schon auf Grund der Länge von Navilles Interjektion) auf die Schnelle und unvorbereitet darauf wirklich eingehen konnte. Das Ziel aber, das sich Sartre für den Anlass gesetzt hatte, wurde verfehlt.
Beängstigend an der ganzen Diskussion und am Vortrag ist nun nicht die Tatsache, dass es Sartre nicht gelingt, sich und seine Position zu definieren. Beängstigend ist, dass in den Kulissen der Veranstaltung ein Gespenst lauert, von dem alle Beteiligten wissen, das aber selbst noch in der vor mir liegenden Ausgabe von 1996 schamhaft verschwiegen wird. (Was nicht verwundern darf, denn bei der Herausgeberin, Arlette Elkaïm Sartre, handelt es sich um Sartres Adoptivtochter und Alleinerbin …) Es sind Stalin und die kommunistische Partei der Sowjetunion, die im Hintergrund dräuen. Die kommunistische Partei Frankreichs war völlig von Moskau abhängig – bis hin zu Personalentscheiden. Entsprechend übernahm sie auch deren Stalin-Kult. Die Verehrung Stalins ist nun aber eine der dunklen Seiten nicht nur der französischen kommunistischen Partei sondern auch Sartres. Auch von ihm gibt es, nicht im vorliegenden Text allerdings, Äußerungen der Verehrung von Stalin und seiner Innen- und Außenpolitik. Dabei waren Stalins skrupelloses und blutiges Vorgehen bei parteiinternen Säuberungen schon längst bekannt und – zum Beispiel von George Orwell – im Westen schon zur Zeit des Spanischen Bürgerkriegs angeprangert worden.
Summa summarum: Ein explosives Büchlein, wenn man die historischen Zusammenhänge berücksichtigt. Ziemlich wirr, wenn man versucht, daraus Sartres Position bzw. seinen Existenzialismus herauszufiltern. Nichts, was man jenseits eines Interesses für Sartre gelesen haben muss.
1) Jean Paul Sartre: L’existentialisme est un humanisme. Présentation et notes par Arlette Elkaïm Sartre. Paris: Gallimard, 1996. (= folio essais 284)