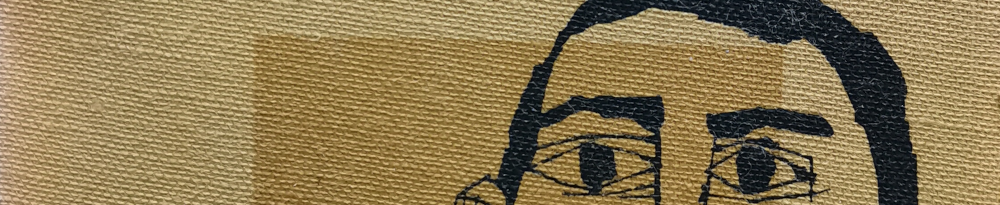1 Josef wurde nach Ägypten hinabgebracht. Ein Ägypter namens Potifar, ein Hofbeamter des Pharao, der Oberste der Leibwache, kaufte ihn den Ismaelitern ab, die ihn dorthin gebracht hatten. 2 Der HERR war mit Josef und so glückte ihm alles. Er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. 3 Sein Herr sah, dass der HERR mit Josef war und dass der HERR alles, was er unternahm, durch seine Hand gelingen ließ. 4 So fand Josef Wohlwollen in seinen Augen und er durfte ihn bedienen. Er bestellte ihn über sein Haus und gab alles, was ihm gehörte, in seine Hand. 5 Seit er ihn über sein Haus und alles, was ihm gehörte, bestellt hatte, segnete der HERR das Haus des Ägypters um Josefs willen. Der Segen des HERRN ruhte auf allem, was ihm gehörte im Haus und auf dem Feld. 6 Er ließ seinen ganzen Besitz in Josefs Hand und kümmerte sich, wenn Josef da war, um nichts als nur um sein Essen. Josef war von schöner Gestalt und von schönem Aussehen. 7 Nach einiger Zeit erhob die Frau seines Herrn ihre Augen zu Josef und sagte: Liege bei mir! 8 Er weigerte sich und entgegnete der Frau seines Herrn: Siehe, mein Herr kümmert sich, wenn ich da bin, um nichts im Haus; alles, was ihm gehört, hat er in meine Hand gegeben. 9 Er ist in diesem Haus nicht größer als ich und er hat mir nichts vorenthalten als nur dich, denn du bist seine Frau. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht begehen und gegen Gott sündigen? 10 Obwohl sie Tag für Tag auf Josef einredete, an ihrer Seite zu liegen und mit ihr zusammen zu sein, hörte er nicht auf sie. 11 An einem solchen Tag kam er ins Haus, um seiner Arbeit nachzugehen. Niemand von den Hausleuten war dort im Haus. 12 Da packte sie ihn an seinem Gewand und sagte: Liege bei mir! Er ließ sein Gewand in ihrer Hand, floh und lief nach draußen. 13 Als sie sah, dass er sein Gewand in ihrer Hand zurückgelassen hatte und nach draußen geflohen war, 14 rief sie nach ihren Hausleuten und sagte zu ihnen: Seht nur! Er hat uns einen Hebräer ins Haus gebracht, seinen Mutwillen mit uns zu treiben. Er ist zu mir gekommen, um bei mir zu liegen; da habe ich laut geschrien. 15 Als er hörte, dass ich laut aufschrie und rief, ließ er sein Gewand neben mir liegen, floh und lief nach draußen. 16 Sie ließ sein Gewand neben sich liegen, bis sein Herr nach Hause kam. 17 Ihm erzählte sie die gleiche Geschichte: Der hebräische Sklave, den du uns gebracht hast, ist zu mir gekommen, um mit mir seinen Mutwillen zu treiben. 18 Als ich laut aufschrie und rief, ließ er sein Gewand neben mir liegen und floh nach draußen. 19 Als sein Herr hörte, wie ihm seine Frau erzählte: Genau das hat dein Sklave mir angetan!, packte ihn der Zorn. 20 Josefs Herr ergriff ihn und warf ihn in den Kerker, den Ort, an dem die Gefangenen des Königs in Haft gehalten wurden.
Zwanzig Verse (minus einen halben), bzw. 491 Wörter oder 2762 Zeichen in der deutschen Einheitsübersetzung, umfasst die Geschichte von Joseph und dem Weib Potiphars1), im 1. Buch Mose, am Anfang des Kapitels 39. Bei Thomas Mann wurden aus diesen paar Wörtern rund 450 eng bedruckte Taschenbuch-Seiten – anders gesagt: das dritte Buch der Josephs-Tetralogie, das längste der vier. Wikipedia, nebenbei, irrt, wenn sie die Zahl der behandelten Verse mit 22 angibt; der zweite Teil von Vers 20 bis und mit Vers 22 weist voraus auf Ereignisse, die Thomas Mann im dritten Teil der Tetralogie nicht mehr abhandelt. Er beendet Joseph in Ägypten ganz bewusst in dem Moment, in dem Joseph in den Kerker geworfen wird, oder, wie er es in den beiden letzten Sätzen des Romans beschreibt:
Also ging es hinab mit Joseph in die Grube und ins Gefängnis zum anderen Mal. Wie er aber wieder emporstieg aus diesem Loche zu höherem Leben, das bilde den Gegenstand künftiger Gesänge.
Das ist ja nun sehr deutlich. Das immer wieder angedeutete Thema der Auferstehung finden wir hier, ganz am Ende des dritten Buchs, in zwei Sätzen, bei denen praktisch jedes Wort ein eindeutiger Hinweis ist darauf, was in viel späteren Zeiten als denen Josephs von einem Wanderprediger namens Jesus von Nazareth erzählt werden wird. Wie überhaupt Thomas Mann das Thema des Menschen, der aus tiefsten Tiefen aufsteigt in höchste Höhen gerade in diesem Band immer wieder andeutet. Wenn es nicht Jesus ist, auf den er hinweist, dann ist es ein anderer, vom dem Joseph träumt: Moses, der als Neugeborener in einem kleinen Schiffchen ausgesetzt, aber von der Tochter des Pharao gerettet wird. Denn Joseph träumt immer mal wieder in diesem Buch.
20 Verse auf 450 Seiten nachzuerzählen, gibt Thomas Mann die Gelegenheit, so vieles hinein zu packen: eine Darstellung des täglichen Lebens der ägyptischen Upper Class zum Beispiel, oder auch Diskussionen der verschiedenen Religionen bzw. Götter. Das geht hin bis zu Schilderungen von Riten, die an solche der neo-ehtnischen Religionen erinnern, die wir zum Beispiel als Voodoo kennen oder zu kennen glauben.
Vor allem natürlich die Geschichte zwischen Joseph und Potiphars Weib wird in ihren Verästlungen detailliert erzählt. Hier interessiert gerade die Lage der Frau den Erzähler. Potiphar ist bei Thomas Mann zwar der Oberste der Leibwache, aber keineswegs ein kriegerischer Mensch – dafür ist sein direkter Untergebener zuständig. Potiphar ist gleichzeitig eine Art Haushofmeister des Pharao. Womit Thomas Mann, nebenbei, abdeckt, dass in der Septuaginta, der kanonischen Übersetzung des Alten Testaments ins Altgriechische, zwei im Hebräischen – das diese Namen dem Ägyptischen entnommen hat – sehr ähnlich klingende Namen, die aber offenbar verschiedene Personen bezeichnen, mit dem gleichen Wort übersetzt wurden, damit aus zwei Personen eine machend. Thomas Mann macht daraus einen friedliebenden Krieger, friedliebend vielleicht auch darum, weil Manns Potiphar ein – Eunuch ist. Das wiederum erklärt gewisse Nöte und Bedürfnisse seiner jungen Gattin (die bei Thomas Mann anders als in der Bibel, einen Namen trägt, nämlich Mut-em-enet). Was zu Beginn vielleicht sogar romantische Liebe gewesen sein mag, wird bei ihr immer mehr zu einer ungesunden Fixierung auf diesen einen Mann, Joseph. Oder zumindest auf eine heiße Nacht mit ihm. Immer verzweifelter werden ihre Versuche, ihn in ihr Bett zu locken. Interpretationen ad hominem mögen sich jetzt fragen, ob in Mut-em-enet eventuell ein Porträt einer gewissen Katia zu finden wäre. Zwar werden dem nun rund 25-jährigen Joseph keine homosexuellen Gelüste zugeschrieben. Tatsächlich scheint er sogar keine sexuellen Gelüste aufzuweisen, was Mann dem Umstand zuschreibt, dass er seiner göttlichen Berufung zu folgen habe. (In Interpretationen ad hominem möchte das vielleicht mit der schriftstellerischen Berufung des Dichters gleichzusetzen sein.) Thomas Mann legt im Text Wert darauf, dass Joseph im Vollbesitz seiner Männlichkeit sei. Er geht so weit, von dessen viel späterer Heirat zu berichten – wahrscheinlich mit einer Ägypterin, eine Ehe, der zwei Söhne entsprossen. Weder diese noch deren Nachkommen aber spielen in der späteren Geschichte des jüdischen Volkes irgendeine Rolle, was der Autor etwas erstaunt zur Kenntnis nimmt. Immerhin prahlt Joseph in diesem Buch noch einmal vor seinem Vorgesetzten damit, der designierte Nachfolger seines Vaters, eines Wüstenkönigs, gewesen zu sein. (Was, wie wir aus dem zweiten Buch der Tetralogie wissen, nicht stimmt: Jaacob dachte zwar, als Joseph noch bei ihm lebte, darüber nach, ihn zu seinem Erstgeborenen und damit Nachfolger zu küren, aber die folgenden Ereignisse machten jede solche Überlegung obsolet. Joseph zeigt also immer noch eitle und lügnerische Züge in diesem Buch.) Es scheint, als möchte Mann hier doch eine gewisse Bestrafung der Vanitas des nach menschlichen Begriffen manchmal eingebildeten Joseph andeuten, der zwar sozusagen eine schöne Blüte am Baum des Judentums darstellt, aber schon zu Lebzeiten für seinen Hochmut dadurch bestraft wird, dass er de facto zum Ägypter wird und seine Nachkommenschaft im ägyptischen Volk aufgeht. (Was Interpretationen ad hominem daraus machen wollen, bleibe ihnen überlassen.)
Summa summarum: Abermals finden wir einen Thomas Mann auf der Höhe seines schriftstellerischen Könnens. Abermals bin ich entzückt – hin und weg.
1) So, wie Thomas Mann konsequent Jaakob für ‚Jakob‘ und Joseph für ‚Josef‘ schreibt, verwendet er auch durchgehend Potiphar für ‚Potifar‘.