Lima, 1904: Zwei arme Poeten sitzen in der Dachkammer eines armseligen Wohngebäudes und schauen auf die Strasse. Zu zweit träumen sie von einer Zeit, wo sie nicht mehr verkannte Poeten sein werden, sondern hoch berühmte, anerkannte. Zu zweit schwärmen sie von ihren Lieblingsdichtern, rezitieren Mallarmé und überhaupt alle französischen Symbolisten. Ihr ganz grosses Idol aber ist der junge spanische Dichter Juan Ramón Jiménez. (Ja, jener Jiménez, der über 50 Jahre nach den Ereignissen, die im vorliegenden Roman geschildert werden, den Nobelpreis für Literatur erhalten sollte.) Jiménez hat gerade im fernen Madrid einen Gedichtband veröffentlicht. Die beiden armen Poeten haben davon gehört, aber in Lima gibt es keine Möglichkeit, dieses Buch zu erhalten.
Das klingt kitschig, ist es aber nicht. Denn die beiden sitzen zwar in der Dachkammer eines armseligen Wohngebäudes, aber das ganze Gebäude gehört dem Vater des einen Poeten. Auch der andere ist keineswegs arm – um ehrlich zu sein, stammen beide aus reichen Familien: José aus alteingesessenem Stock, Carlos ist der Sohn eines Self-made-Man, der gerade mit Kautschuk reich geworden ist. Auch sind sie keine verkannten Poeten, auch wenn sie sich so fühlen. Denn ihre Umgebung, die Verleger und die Redakteure literarischer Zeitschriften, schätzen ihre Gedichte nach ihrem tatsächlichen Wert ein – will sagen: sie sind tatsächlich nichts wert. Ihre Dichterei, ihr Schwärmen vom französischen Symbolismus und von Juan Ramón Jiménez sind nicht mehr als spätpubertäres Gehabe, keine tiefstinnere Berufung.
Nichts desto trotz: Im Moment hätten sie wirklich gerne den neuesten Lyrikband des Spaniers in Händen, und sie kommen wirklich nicht daran. Was liegt näher, als Juan Ramón Jiménez zu schreiben mit der Bitte, er möchte ihnen doch ein Exemplar schicken? Nur: Weshalb sollte der Spanier zwei jungen Fans diese Bitte erfüllen? Sie beschliessen, taktisch vorzugehen. Sie erfinden eine junge Frau namens Georgina Hübner (!), die an ihn schreibt. Der Trick funktioniert, er schreibt zurück und legt sein neuestes Werk bei. Das weckt nun den Ehrgeiz der beiden: Wie wäre es, wenn sie ihn so weit bringen könnten, dass er an, für und über Georgina Hübner ein Gedicht schreiben würde? Sie schreiben zurück und tatsächlich entwickelt sich eine längere Korrespondenz. Juan Ramón Jiménez scheint sich auch irgendwie in Georgina zu verlieben – aber Gedicht gibt es keines. Dafür entwickelt der junge Carlos mehr und mehr Gefühle für sein eigenes Geisteskind.
Der Roman stellt nur bedingt eine Liebesgeschichte vor. Er ist schon eher die Geschichte dessen, wie sich José und Carlos von schwärmenden Jünglingen zu Männern entwickeln. Zu sehr gewöhnlichen Männern entwickeln. Es ist ein Künstlerroman, weil es im Grunde genommen immer wieder ums Schreiben geht. Aber er beschreibt nicht, wie sich ein junger Mensch, oder auch deren zwei, zu Schriftstellern entwickeln. Er schildert, wie sich José und Carlos gerade nicht zu Schriftstellern entwickeln, sondern zu ganz durchschnittlichen, schon mit Mitte 30 Fett ansetzenden Grossbürgern, mit Frau und Kindern, die klag- und problemlos in die Fussstapfen ihrer Väter getreten sind.
Juan Gómez Bárcena hat Literatur und Geschichte studiert und lehrt in Madrid „Kreatives Schreiben“. Er weiss also, wie Literatur funktioniert. Das merkt man dem Roman Der Himmel von Lima auch an. Da schreibt wirklich einer, der alle Tricks beherrscht. Juan Gómez Bárcena versteht es, seine Geschichte mit grosser Ironie und doch liebevoll zu verpacken. Und doch fehlt der Geschichte das letzte, das gewisse Etwas. Sie ist allzu gut konstruiert und deshalb in jeder Phase vorhersehbar. Ich finde als Leser keine Risse oder gar Spalten, in die ich einzudringen wünschen könnte. Es geht mir mit dem Himmel von Lima, wie seinerzeit mit Neil Gaimans American Gods:
Die Story ist glatt geschliffen wie eine Marmorkugel. Aber das Wasser meines Interesses perlt daran ab.
Die Story ist originell. (Ich weiss nicht, ob dieser Hoax auf einer realen Geschichte beruht, dafür kenne ich das Leben von Juan Ramón Jiménez zu schlecht.) Die Ausführung hat Zug und ist gut gemacht. Der letzte Tick fehlt, dennoch kann man das Büchlein mit Gusto lesen.
Nehmen wir einmal an, wir müssten José und Carlos mit einer einzigen Zeile beschreiben, uns wären nicht mehr als, sagen wir, zehn Wörter über die beiden gestattet – ihr gesamtes Dasein in Form eines Telegramms. In diesem Fall würden wir womöglich folgendes sagen:
Sie sind reich.
Sie halten sich für Dichter.
Wollen Jiménez sein.
Aber glücklicherweise verlangt niemand, dass wir uns so kurz fassen.
S. 19
Juan Gómez Bárcena: Der Himmel von Lima. Aus dem Spanischen von Steven Uhly. Zürich. Secession Verlag für Literatur, 2016.

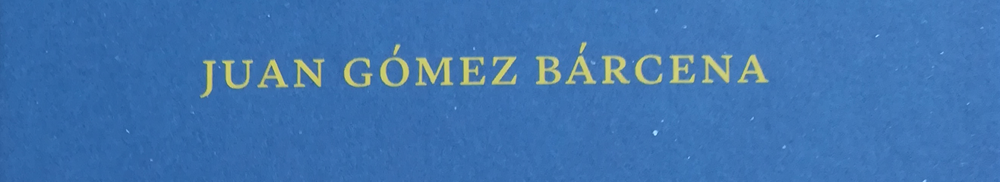
Ich bin beeindruckt von diesem Roman und kann dir großteils zustimmen. Die Story mag zwar glatt geschliffen sein, aber auf eine gelungene Weise. Denn es hätte hier einige Abzweigungen gegeben, durch die sich banale oder triviale Wendungen ergeben hätten. Das hat er wirklich gut umschifft, ich finde den Roman überaus gelungen. Dass Bárcena einer dieser – eher unseligen – akademisch bestallten Creativ-writer ist, merkt man kaum (außer man will die Souveränität, mit der er den Stoff handhabt, ihm vorwerfen). Ein beachtliches Stück Literatur.