Vor etwas mehr als 100 Jahren (1920 rückwirkend für 1919 verliehen) hat mit Carl Spitteler der einzige gebürtige Schweizer den Nobelpreis für Literatur gewonnen (Hermann Hesse, der zweite und bisher letzte Schweizer, der den Preis 1946 erhielt, kam 1877 noch als Bürger des damaligen Deutschen Reichs zur Welt.) Das Werk, für das er besonders geehrt wurde, sein Epos Olympischer Frühling von 1905, ist für heutige Begriffe fast ungenießbar. Aber es gibt durchaus Texte von Spitteler, die auch im 21. Jahrhundert noch lesbar sind.
So einer ist zum Beispiel das Idyll (so auf dem Titelblatt) Gustav. Es erschien 1891 und ist eine Art Seitenstück zum längeren Roman Das Wettfasten von Heimligen, der ein Jahr früher erschienen ist. Es teilt sich mit dem Roman den Handlungsort, die fiktive Gemeinde Heimligen, die recht ungenau irgendwo im so genannten Oberland des Kantons Zürich lokalisiert ist.
Gustav ist auch der Name des Protagonisten, eines jungen Mannes, der an der Universität durch die medizinischen Examen gefallen ist, und nun ohne Arbeit und ohne reguläre Ausbildung in sein Heimatdorf zurückkehrt. Wir erleben mit ihm einen Frühling, einen Sommer und einen Herbst, in denen er nicht nur zu seiner eigentlichen Bestimmung als Musiker findet, sondern auch in der Neuenburger Freundin des halben Dutzend Pfarrerstöchter in der Nachbarschaft, die diesen Sommer ebenfalls zu Besuch in Heimligen weilt, seine Braut. In den paar Monaten reift der junge Bummelant zum zielgerichteten, seiner Möglichkeiten und Fähigkeiten bewussten Künstler.
Spittelers Sprache trifft den Idyllen-Ton sehr gut. Vor allem die Schilderung unbelebter Objekte (Natur oder – noch besser – Artefakte wie Gartenwerkzeug) gelingt ihm. Dabei verwendet er einen Stil, der mit seinen eingestreuten Helvetismen ‚heimelig‘ klingt (das Schweizer Wort für ‚an die Heimat erinnernd, gemütlich‘) und an Jeremias Gotthelfs Stil erinnert (wobei Spitteler weniger Dialektismen einstreut als der Berner Pfarrer). Gleichzeitig verweigert sich der Atheist Spitteler aber metaphysisch-theologischen Exkursen und erinnert hierin wiederum an gewisse Novellen Gottfried Kellers. Mit Keller teilt er auch einen ironisch-bärbeißigen Erzählton. Es erstaunt allerdings, dass – bei all den sehr gelungenen Schilderungen von toten Objekten und von Landschaft – Gustav ausgerechnet Komponist sein bzw. werden soll. Denn zur Musik fällt Spitteler, außer ein paar Allgemeinplätzen, nichts ein, während er in der Malerei besser Bescheid zu wissen scheint.
In meiner Ausgabe (die in etwa Taschenbuchgröße aufweist) umfasst die Geschichte nicht ganz 80 Seiten, die an einem sonnigen Nachmittag zu lesen ich empfehle. Gotthelf und Keller überragen Spitteler bei weitem, aber die unaufgeregte Art, wie Spitteler die Nöte eines sich selber noch suchenden Künstlers schildert, ist durchaus eine Lektüre, für die Zeit sich genommen zu haben, man nicht bereuen wird.

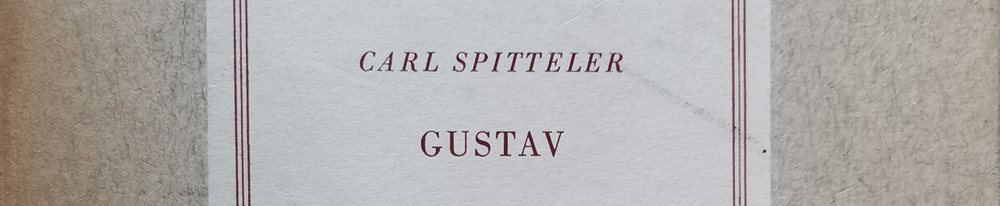
Hermann Hesse hatte zunächst die von seinem Vater aus dem Baltikum mitgebrachte russische Staatsangehörigkeit geerbt und 1883, wiederum mit dem Vater, das Basler Bürgerrecht erworben. Das ist ja wohl in der Schweiz auch heutzutage noch so, dass man primär nicht in die Eidgenossenschaft als solche und auch nicht in einen Kanton eingebürgert wird, sondern in eine Gemeinde. Erst 1890 wurde Hesse junior rechtlich Württemberger, damit er in Maulbronn aufgenommen werden konnte.
Was Spitteler betrifft: „Imago“ habe ich noch geschafft, aber „Prometheus“ ging nach etwa einem Drittel wirklich nicht mehr, allein schon wegen der hartnäckig durchgehaltenen Schreibweise „der Engelgottes“.