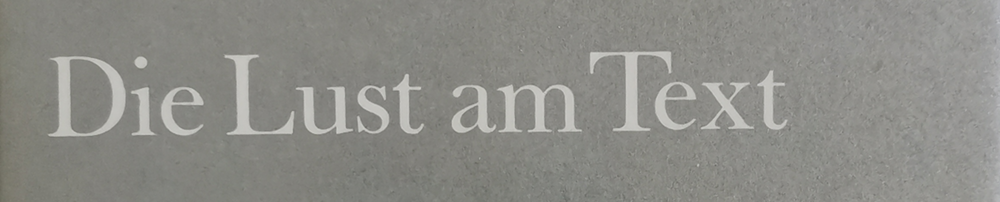Um Roland Barthes kam man zu meiner Zeit im Studium nicht herum. Genauer: in einem literaturwissenschaftlichen Studium. Die Philosoph:innen und auch die Sprachwissenschaftler:innen konnten mit dem französischen Poststrukturalismus, und somit auch mit Barthes, wenig anfangen. Nach langen Jahren habe ich ihn nun wieder einmal ausgegraben. Noch heute verstehe ich die Faszination, die er auf Literaturwissenschaftler:innen ausgeübt haben musste – sind doch seine Texte weniger Erklärungen und Interpretationen, sondern vielmehr selber der Erklärung und der Interpretation bedürftig. Jedenfalls, was das vorliegende schmale Büchlein betrifft. Die Lust am Text stellt keinen kohärenten Diskurs dar, sondern besteht aus vielen kürzeren und längeren ‚Kapiteln‘, die man am ehesten Aphorismen nennen könnte. Aphorismen haben für die Schreibenden den nicht zu verachtenden Vorteil, dass sie untereinander nicht zusammenhängen und nicht kohärent zu sein brauchen.
Barthes nun ist auch innerhalb eines Aphorismus nicht kohärent. Oder allenfalls, wenn man seine spezielle Verwendung einer Dialektik als Kohärenz betrachtet – denn er geht darin weit über das hinaus, was wir uns bis bereits von Hegel-Marx-Lenin’schen Diskurs gewöhnt waren. Während ich früher nicht sicher war, ob es nicht einfach meine eigene mangelnde Intelligenz oder vielleicht auch nur mangelnde Übung war, die mich daran hinderte, die Poststrukturalisten (es waren in diesem Fall wirklich alles Männer) zu verstehen, vermute ich heute, dass sich Barthes & Co. nur allzu oft von ihren eigenen Worten davon tragen liessen. Eine Art philosophischer écriture automatique also. Oder, wie es Barthes selber von einer gewissen Art Literatur formuliert: Sie plappern.
So wird nie ganz klar, was denn nun die Lust am Text hervorruft. Barthes setzt Lust der Wollust entgegen, sie aber doch manchmal wieder in eines. Lesen ist bei ihm eine Art erotischer Akt, hat aber dann doch weder mit erotischer noch gar mit pornografischer Literatur zu tun. Es ist eine Art sublimierter Voyeurismus, den Barthes den Lesenden anmutet. Der Text als Körper, dessen Entblößung (oder eben Nicht-Entblößung) sie beiwohnen. Die Schreibenden, die offenbar im Akt des Schreibens eine eigene Art von Lust empfinden, bleiben bei Barthes‘ Akt des Lesens außen vor. Die Lesenden als Zuschauende in einem Striptease-Lokal, die mit einer (wie Barthes selber sagt) pennälerhaften Ungeduld auf die Entblößung des Geschlechts warten – nur um zu erleben, dass in diesem Moment die Vorstellung für beendet erklärt wird und sie auf eine neue zu warten haben.
Richtiges Lesen, wenn ich Barthes korrekt interpoliere, wäre wohl, die Spannung auszuhalten, die zum Beispiel entsteht, wenn in der Kleidung eines Menschen an einer Stelle eine Lücke klafft, an der ordnungsgemäß keine zu klaffen hätte. Und hier, muss ich gestehen, habe ich für meine eigene Lektüre tatsächlich etwas von Barthes und den Poststrukturalisten übernommen. Eine rundum glatte literarische Lektüre vermag mich zwar zu faszinieren, wird mich aber selten ganz zufrieden zurücklassen. Wie ein Mann in einem knöchellangen Kaftan zwar einem mathematisch perfekten Kegel gleichen mag, aber keinerlei erotisches Interesse weckt, so ist ein völlig glatt polierter Text letzten Endes für mich (in den meisten Fällen) einfach nur langweilig. Blitzt dagegen ein Stück Haut auf oder lässt sich auch nur die Form des Knöchels erahnen, will sagen: erahne ich (zum Beispiel) einen inhärenten Widerspruch, so wird in meinem lesenden Ich der Voyeur wach, der mehr sehen möchte und deshalb aktiv mehr zu suchen beginnt; der Voyeur wird zum Detektiv, der Leser zum Mit-Autor. (Das geht, wenn ich das richtig sehe, über Barthes hinaus – dass die Lesenden zu Co-Autor:innen mutieren, habe ich in Die Lust am Text nicht gefunden.)
Im Übrigen ist es vielleicht auch interessant, an welchen Autoren Barthes seine Theorie … nein, nicht demonstriert, das tut er, wie gesagt nicht … aber: gefunden oder bestätigt gefunden zu haben glaubt: Proust an erster Stelle, des weiteren de Sade und Flaubert. Einige Surrealisten. An Philosophen finden wir Bataille und – Nietzsche (was einiges erklärt, wie ich finde). Weitere Nennungen wird das geneigte Publikum in den Schlagwörtern finden. Auffallend vielleicht noch die Nennung von Thomas Hobbes. Der verdankt das einem Satz, den Barthes auch als Motto vor das ganze Buch gesetzt hat: Die einzige Passion meines Lebens war die Angst. (Und dieser Satz stammt nicht aus Hobbes‘ philosophischen, sondern aus seinen autobiografischen Schriften …)
Eine zur Lust am Text gehörende Zeichentheorie, wie Barthes es impliziert, finde ich nicht. (Nebenbei: Man findet in diesem Text, der im Original von 1973 stammt, immer den Begriff Semiologie dafür verwendet, obwohl Barthes offenbar zu jenen Mitgliedern der International Association of Semiotic Studies gehörte, die eigentlich schon 1969 beschlossen hatten, an dessen Stelle nur noch Semiotik zu verwenden. Da die Übersetzung von Traugott König unter Mithilfe Barthes‘ entstanden ist, wird hier also wohl dessen Original-Verwendung wiedergegeben sein. Ob der Franzose uns damit etwas sagen wollte, bleibe dahingestellt.)
Alles in allem mehr eine interessante Erinnerung an eine interessante Zeit in meinem Leben als eine wissenschaftliche (Wieder-)Entdeckung. Ich für meine Teil gehe nun lieber wieder hin und ziehe andere Texte aus. 🙂
Roland Barthes: Die Lust am Text. Aus dem Französischen von Traugott König. Frankfurt/M: Suhrkamp, 1980. (= Bibliothek Suhrkamp 378)