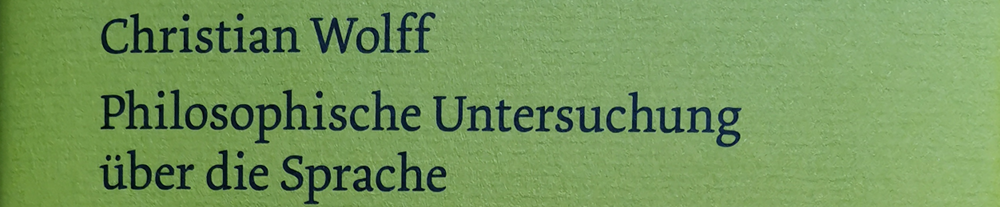Lernen die Studierenden der Philosophie (wenn das Fach überhaupt noch existiert und nicht wegen mangelnder ökonomischer Verwertbarkeit gleich ganz von der betreffenden Universität verbannt wurde) Christian Wolff heute noch kennen? Zu meiner Zeit war er uns noch ein Begriff. Und zwar genau das, nicht mehr und nicht weniger: ein bloßer Begriff. Was wir von ihm wussten, war im Grunde genommen nur, dass er Leibniz‘ Philosophie der prästabilierten Harmonie systematisiert und popularisiert und damit die deutsche bzw. deutschsprachige Philosophie für rund ein Jahrhundert in den dogmatischen Schlummer versetzt hatte, aus dem sie erst Kant wieder wecken sollte – ohne ihn vorerst völlig zu verdrängen. Zu lange hielten noch zu viele amtlich besoldete Katheder-Professoren an ihrer Dogmatik fest. (Tatsächlich konnte noch ein Wilhelm Raabe, 1891 in Stopfkuchen, seine beiden ständig mit Bildungsbrocken um sich werfenden Protagonisten Heinrich und Eduard den Namen Wolffs so ganz nebenbei in die Unterhaltung werfen lassen – und dies, obwohl Raabe selber kein abgeschlossenes Universitätsstudium vorweisen konnte, nicht einmal ein Abitur.) Heute allerdings, fürchte ich, haben die Studierenden nicht einmal Wolffs Namen mehr gehört. (Oder den Raabes, quant à ça.)
Rainer Specht, der Herausgeber meiner Ausgabe*) hegt dieselbe Vermutung. Als Schuldige daran nennt er die deutsche Klassik. Mir ist nicht ganz klar, wen oder was er damit meint. Wohl haben die deutschen Klassiker die deutsche Schriftsprache auf ein vorher nicht gekanntes Niveau angehoben. Aber gerade im philosophisch-technischen Bereich, wo viele Wörter darauf warteten aus dem Latein ins Deutsche übertragen zu werden, waren sie ja kaum tätig. Wieland, ehemaliger Professor für Philosophie, beschäftigte sich in seinen belletristischen Werken vor allem mit den Philosophen der Antike. Herder wetzte sich praktisch nur an Kant, ebenso Schiller. Und Goethe nun war alles andere als ein philosophischer Kopf. Wenn Rainer Specht mit seiner Bemerkung allerdings an Kant denkt, hat er Recht damit – während Wolff zu seiner Zeit als auf Deutsch schreibender Philosoph noch die Ausnahme war, wurde es nach Kant zusehends zur Regel, auf Deutsch zu publizieren.
Die kurze Abhandlung Disquisitio philosophica de loquela ist allerdings ein frühes Werk Wolffs. Er war bei dessen Verfassen gerade mal 25 Jahre alt und stand am Anfang seiner akademischen Karriere. Er war gerade Professor für Mathematik geworden und hielt sich nun mit solchen kurzen Texten in Erinnerung für allfällige weitere Berufungen an andere Universitäten. Deshalb ist der Text auch auf Latein verfasst. Aber nicht nur die Sprache ist im Vergleich zu den späteren Schriften Wolffs eine andere – auch die Grundeinstellung zum im Mittelpunkt der Abhandlung stehenden so genannten Leib-Seele-Problem ist noch eine andere. Es geht hier (unter anderem) am Beispiel der gesprochenen Sprache (loquela bedeutet eigentlich immer die gesprochene Sprache!) darum, wie die als unkörperlich gedachte Seele, die ihren Sitz in der Zirbeldrüse hatte, die Sprechwerkzeuge in Bewegung setzen kann. Als unkörperliches Wesen kann die Seele ja nicht direkt körperliche Dinge wie Zunge oder Gaumen Einfluss nehmen. Wolff übernimmt für diesen Aufsatz die Lösung des Descartes, die davon ausgeht, dass der liebe Gott, bei jeder Willensäußerung der Seele die entsprechend notwendigen körperlichen Bewegungen in Gang setzt. Auch war Wolff später nie mehr so nahe an Spinozas Überlegungen zu einer Einheit des Geistes in der Natur, wie in dieser Schrift. Leibniz, der deswegen mit dem aufstrebenden jungen Professor in Briefkontakt trat, rügte ihn, seine (Leibniz‘) Schriften nicht oder nicht genau genug gelesen zu haben. Tatsächlich kannte Wolff damals (1703) Leibniz praktisch nicht; er sollte aber die Lektüre ziemlich rasch nachholen und sich völlig zu Leibniz‘ Lösung des Leib-Seele-Problems bekehren – nämlich, dass zwischen Leib und Seele die viel gerühmte prästabilierte Harmonie herrsche. Wie zwei völlig identische und völlig identisch ablaufende Uhrwerke sollte, was die Seele wollte, zugleich, quasi automatisch, auch vom Leib ausgeführt werden. Und umgekehrt.
Inhaltlich ist Wolffs Text vor allem den Philosophie- und allenfalls den Wissenschaftsgeschichtstreibenden interessant. Wolff kennt und weiß in seinen jungen Jahren schon einiges (er galt als „shooting star“ in der Szene!), und so berührt er hier
[…] aktuelle metaphysische Richtungen, erwähnt aber auch analytische Geometrie, Geheimsprachen, Kunstsprachen, Linguistik, Taubstummenunterricht, Zauberei, Anatomie, Akustik, geometrische Optik und phonetische Maschinen. In das heute gebräuchliche Epochenschema passt er am ehesten, wenn man ihn der deutschen Frühaufklärung zuordnet.
Vorwort, S. XIV
Zu nennen wären noch weitere Disziplinen, die Wolff mehr oder weniger intensiv bewirtschaftet: Er macht sich auch seine Gedanken zur Logik und zur Semiotik, zu einer möglichen Universalsprache ganz im Sinne Chomskys, oder zur Physik (die damals die ganze wissenschaftliche Welt bewegende Frage einer möglichen Existenz des Vakuums!). Selbst theologische Fragen schließt er aus seinen Überlegungen nicht aus.
Was das vorliegende Buch mit der Neuübersetzung aber in meinen Augen wirklich interessant macht, ist sein Aufbau. Der eigentliche lateinische Text wird ganz am Schluss en bloc vorgestellt. Den Großteil des Textes aber macht – nein, nicht die Übersetzung, sondern – der Kommentar des Herausgebers aus. In Fließtext, nur gesondert durch eine je eigene Schriftart, folgen auf die Kapitelüberschriften bzw. Paragraphennummern zunächst eine kurze, erklärende Inhaltsangabe; dann philosophiegeschichtliche Verweise auf Herkunft und Verwendung der Begriffe vor Wolff (bis zurück in die Antike, aber auch bei Thomas von Aquin, Pierre Gassendi oder Antoine Arnaud); in diese wiederum eingefügt, Sach- und Personenerklärungen, vor allem natürlich zu Begriffen und Personen, die im philosophischen Diskurs des beginnenden 18. Jahrhunderts noch ganz anders verwendet wurden (die Begriffe) bzw. damals auf dem Höhepunkt ihrer Bekanntheit und ihres wissenschaftlichen Einflusses standen, heute aber noch weniger bekannt sind als Wolff selber (die Personen). Auf diese Weise gelingt es dem Herausgeber, ein ausgezeichnetes Bild jener Periode des Umbruchs in der Philosophie zu zeichnen, die heute praktisch unbekannt ist. Damit stellt dieses Buch bedeutend mehr dar, als eine Neuausgabe einer verschollenen und unwichtigen Jugendschrift eines seinerseits verschollenen und unwichtigen Philosophen des beginnenden 18. Jahrhunderts.
Das Buch bietet gutes Beispiel dafür, wie man an Hand eines einzigen, dazu noch kurzen Textes dem Publikum einen Einblick bieten kann in den quirligen philosophischen und wissenschaftlichen Betrieb einer Epoche. Auch und gerade wenn und weil Christian Wolff heute ein Verschollener ist.
*) Christian Wolff: Disquisitio philosophica de loquela / Philosophische Untersuchung über die Sprache. Lateinisch – Deutsch. Übersetzt, kommentiert und herausgegeben von Rainer Specht. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 2019. (= Philosophische Bibliothek Band 727)