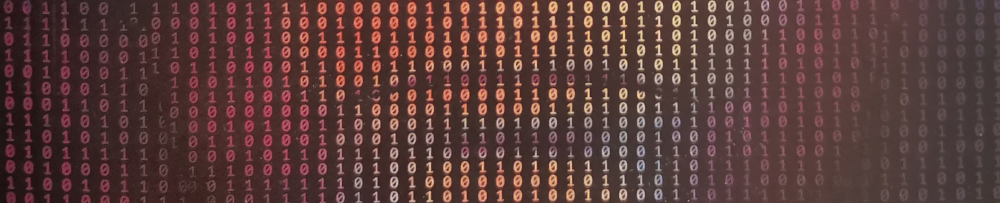scheichsbeutel hat vor rund 4½ Jahren dieses Buch schon einmal vorgestellt. Er nannte es damals ein kluges Buch, das den utopischen bzw. dystopischen Platitüden geschickt entgeht. Beeindruckend die Weitsicht des Autors, der sehr viele Fragen, die erst in unserer Zeit aktuell wurden, voraussieht. Die Transparenz von Personen, die ihre Daten in ein Netz einspeisen und selbst schließlich keinen oder nur eingeschränkten Zugriff auf diese Daten haben, deren Nutzung durch mächtige bzw. staatliche Organisationen (die natürlich vorgeben, nur das Menschenwohl im Auge zu haben), die Ohnmacht des einzelnen, sich dem zu entziehen. Und auch die Versuche, genetisch manipulierte Übermenschen zu erzeugen (allerdings eingebunden in eine etwas krude Wissenschaftskritik) waren für das Jahr 1975 (dem Erscheinungsjahr) visionär. Dass die Geschichte selbst einem eher gängigen Strickmuster gehorcht (Einzelkämpfer nebst Geliebter besiegt eine Übermacht) tut dabei dem Lesevergnügen keinen Abbruch […]. Diese sehr positive Kritik hatte mich viel später dann dazu bewogen, mir – ein anderes Buch Brunners zu kaufen: Stand on Zanzibar, oder Morgenwelt, wie das Buch seltsamerweise auf Deutsch heißt. Stand on Zanzibar ist 8 Jahre älter als The Shockwave Rider und hat mich vor allem auf Grund seiner Kompositionstechnik begeistert. In kleinen Abschnitten werden uns Textfetzen geliefert, die in irgendeiner Form aus der Morgenwelt stammen. Auf diese geschickte Art und Weise liefert uns Brunner peu à peu ein Bild der Welt und vermittelt uns zugleich das Lebensgefühl, das die Menschen in jener Zukunft gehabt haben müssen. (Natürlich stammt die Technik von John Dos Passos, das gibt Brunner auch zu. Aber das schmälert das Lesevergnügen nicht.)
Nun war Brunner klug genug, zu wissen, dass er die Technik aus Stand on Zanzibar kein zweites Mal verwenden durfte, ohne sein Publikum zu langweilen. Für The Shockwave Rider suchte er also nach einer anderen Technik. Und damit komme ich zu jenen Punkten in Brunners Buch von 1975, die machen, dass ich (in Bezug auf die behandelten Themen scheichsbeutel zustimmend) den Shockwave Rider bedeutend weniger schätze als Stand on Zanzibar des gleichen Autors. Brunner verwendet über weite Strecken des Shockwave Rider die Technik der Retrospektive. Er tut dies, indem er mit der Situation beginnt, dass Nick Haflinger, der Held des Buchs, von der Organisation Tarnover gefangen genommen wurde und nun verhört wird. Dabei wird eine Technik eingesetzt, die macht, dass der Verhörte die Wahrheit erzählen muss. Offenbar ist sie aber, zu oft verwendet, schlecht für die Gesundheit der Verhörten, weshalb von Zeit zu Zeit Verhöre stattfinden, bei denen der Proband nicht unter Drogen steht. So wechselt die Erzählebene von Zeit zu Zeit aus der Vergangenheit Haflingers in dessen Gegenwart, die Verhör-Situation. Das ist an und für sich ein kluger erzähltechnischer Trick, wenn man geradliniges chronologisches Erzählen aus Gründen der Abwechslung vermeiden will. Hier allerdings stellt sich Brunner damit selber ein Bein. Denn bei einem Abenteuerroman (und etwas anderes ist ein Science Fiction-Roman in den seltensten Fällen) ist die Erwartung des Publikums nach vorne gerichtet: Wie geht es weiter, welche Komplikation kommt als nächstes auf die Protagonist*innen zu? Hier aber wissen wir bereits, wo all die Rückblicke hinführen, und wir werden bei der Lektüre ungeduldig. Das Interesse, das das Erzählen in Retrospektiven generieren soll, wird konterkariert durch den Umstand, dass wir Lesenden ja das Ende dieser Geschichte(n) kennen: Haflinger wird gefangen gesetzt. Mit anderen Worten: Auf Grund der zu lange durchgehaltenen Erzähltechnik der Retrospektive geht jede Spannung in Bezug auf den Ausgang des Erzählten verloren. Der Roman ist in drei Bücher unterteilt (die jeweils auch ungefähr ⅓ des Ganzen umfassen), von denen erst das dritte die Erzählung in der Gegenwart des Protagonisten weiterführt. Dann aber übertreibt es Brunner in die andere Richtung und tut es nicht mehr unter verschiedenen Bomben (darunter einer Atombombe), die losgelassen oder im letzten Moment verhindert werden. Erzähltechnisch hinkt das Buch also auf allen Beinen, und das stört das Vergnügen (jedenfalls meines) doch beträchtlich.
Im Übrigen haben wir hier tatsächlich eine Variante des Motivs ‚hochbegabter, aber gesellschaftlich ungeschickter Mann trifft auf eine weniger begabte, aber gesellschaftlich fitte junge Frau und rettet mit ihr zusammen die Welt‘. Ein Motiv, das schon Robert A. Heinlein 20, ja 30 Jahre früher in seine ‚Juveniles‘ ausgelutscht hatte (um im Bereich der Science Fiction zu bleiben). Natürlich ist der Held zu Beginn auch ein (durch seine kindlichen und jugendlichen Erfahrungen) emotionaler Krüppel, der von der Heldin zur Liebe bekehrt wird.
In Bezug auf die genetischen Manipulation von Lebewesen ist die Haltung des Buchs sehr ambivalent. Wie dem junge Haflinger einer der Versuche einer Ab-ovo-Züchtung eines hyperintelligenten Menschen vorgestellt wird – eine Züchtung, die noch weit von jedem Erfolg ist, da das aktuell vorhandene ‚Exemplar‘ ein kleines Mädchen ist mit nur dem halben Rumpf, ohne Sprache und auf lebenserhaltende Maschinen angewiesen – wird ihm plötzlich bewusst, dass er das nicht will: genetische Experimente mit Menschen. Wie er aber in Precipice, einer Art öko-alternativer Hippie-Community (ohne sexuelle Promiskuität allerdings), seiner letzten Zuflucht, genetische manipulierte Hunde vorfindet, scheint ihn das nicht zu stören. Liegt es daran, dass die Leute von Precipice die ‚Guten‘ sind, während jene von Tarnover, wo Haflinger seine Ausbildung erhalten hat, die ‚Bösen‘ darstellen? Liegt es daran, dass es ‚nur‘ Hunde sind? (In diesem Fall sogar sehr nützliche Hunde, können sie doch bei der Verteidigung von Precipice eingesetzt werden, als diese Stadt von staatlich aufgestachelten Horden angegriffen wird.) Weder der Autor noch sein Protagonist sind sich offenbar dieses Zwiespalts bewusst – er wird nicht thematisiert.
Später, ganz am Schluss, wird Haflinger eine Art utopischer Verfassung für die nunmehr durch sein Computer-Programm von Korruption befreiten USA vorstellen, das im Grunde genommen nichts anderes ist als eine Steuerreform. (Zugegeben: Über das Thema ‚Steuern‘ bzw. ‚Steuerhinterziehung‘ oder ‚Steuervermeidung‘ kann man die Bürger*innen praktisch immer packen.) Im Kern besteht diese Reform darin, dass in Zukunft eine Art Bonus-System errichtet werden soll, nach dem, wer mehr Bonus-Punkte hat, weniger Steuern zahlen muss. Und Bonus-Punkte kriegt, wer sich mehr für die Gemeinschaft einsetzt. Brunner bzw. Haflinger bringt das Beispiel eines Arztes, der weniger Steuern bezahlen muss, wenn er – neben den Stunden in seiner Praxis – sich noch als Notfallarzt außerhalb der eigentlichen Bürozeiten zur Verfügung stellt. Nun ist das ein Beispiel, das wohl allen einleuchten wird (vielleicht mit Ausnahme der Ärzte und Ärztinnen, die nun nach einem harten 9-Stunden-Tag in ihrer Praxis noch moralisch verpflichtet sind, weitere Stunden für die Gemeinschaft zu leisten – wahrscheinlich auch noch ohne Bezahlung). Doch die simple Theorie würde in der Praxis sehr rasch sehr kompliziert, indem voraussichtlich in jedem Fall von neuem entschieden werden müsste, wie sehr eine bestimmte Tätigkeit der Gemeinschaft dienlich ist. Irgendwer müsste das entscheiden, und irgendwer müsste über die Entscheidungen wachen, und irgendwer müsste seinerseits entscheiden, in welche Steuerklasse die Entscheider gehören – das System würde an seiner eigenen Komplexität ersticken, bevor auch nur ein Dollar an Steuern geflossen wären. Was nach simplem Utilitarismus klingt, würde der Alptraum des neuen Staats.
À propos Staat: Wohl auf Grund eigener schlechter Erfahrungen im Militär beweist Brunner eine außerordentliche Abneigung gegen eben dieses. (Schon in Stand on Zanzibar war es das Militär, das einen hochsensiblen jungen Mann zum Killer abrichtete und ihn so in den Wahnsinn trieb.) Hier ist es nicht direkt das Militär aber eine ähnlich organisierte, geheime Organisation im Dienst des Staats. Es fällt auf (und ist Teil der leider übermäßig vereinfachten Konstruktion der Story), dass alle staatlichen Organisationen korrupt sind – und ‚böse‘. Das Bild der ‚Guten‘ vs. ‚Bösen‘ ist in diesem Roman Brunner letzten Endes genau so simpel und schwarz-weiß gehalten, wie in irgendeinem Heftchenroman der 1920er oder 1950er. Einen seltsamen Dreh hat Brunner allerdings eingefügt: Die staatlichen Organisationen sind allesamt ‚böse‘, die sie vertretenden Individuen aber allesamt nur dumm (weshalb sie unser Script-Kiddie denn letzten Endes auch problemlos über die Ohren haut). Eine Ausnahme ist nur Freeman, der ursprünglich das Verhör Haflingers leitete, zum Schluss aber ihm und seiner Freundin zur Freiheit verhilft.
Ein weitsichtiges Buch, wie es scheichsbeutel formuliert hat, ist es auf jeden Fall. In seiner Weitsichtigkeit, mit der es auf Probleme hinweist, ist es auch klug. Die Probleme werden aber nicht in jedem Fall in ihrer ganzen Tiefe erfasst, und die Lösungen dazu, wo welche geliefert oder angedeutet werden, ebenfalls nicht. Wenn ich einen Roman von John Brunner empfehle müsste, wäre es sicherlich Stand on Zanzibar. Personen wie Probleme sind dort ein bisschen differenzierter dargestellt, und auch die verwendete literarische Technik ist der geschilderten Welt und den geschilderten Ereignissen angepasst, was hier leider nicht der Fall ist. Auch wenn es natürlich jede Menge Romane aller Genres gibt, die noch viel mehr an solchen Fehlern leiden, so ist doch The Shockwave Rider weder erzählerisch noch thematisch ganz durchdacht, ganz gelungen.