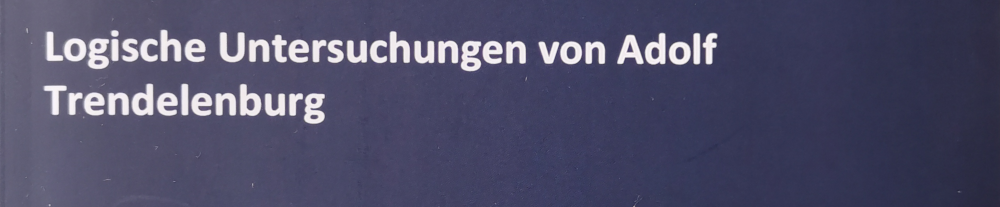Ich war mir ursprünglich nicht sicher, ob ich den zweiten Band der Logischen Untersuchungen von Adolf Trendelenburg hier auch noch vorstellen sollte – ja, ob ich ihn überhaupt noch lesen sollte. Schließlich habe ich es doch getan (den Band gelesen nämlich), weil Teil II zwar in Bezug auf seine ‚Gesamtphilosophie‘ wenig Neues bringt, Trendelenburgs Position aber noch klarer darstellt als der erste Band.
Erinnern wir uns: Trendelenburg war der Meinung, dass die Philosophie den Naturwissenschaften sozusagen die allgemeinen Richtlinien zur Forschung vorgeben sollte. Die Philosophie sollte immer noch das ‚Ganze‘ umfassen – eine Art philosophische Biedermeier-Version der modernen physikalischen ‚Theorie von Allem‘. Als grundlegend in der Natur sah Trendelenburg dabei die Bewegung an, die überall aufzufinden sei.
Nicht ganz überraschend fährt dann der zweite Band fort mit einer Darstellung der Zweckmäßigkeit aller Einrichtungen in der Natur. Ich habe den zweiten Band nicht in der zweiten Auflage wie den ersten gelesen, sondern in der dritten von 1870. So figuriert hier denn auch schon als prominenter Zeuge dieser Zweckmäßigkeit aller natürlichen Einrichtungen Charles Darwin (bzw. seine deutschen Exegeten) mit seiner Evolutionstheorie von 1859. Das berührt uns heute vielleicht ein wenig sonderbar, aber man sollte nicht vergessen, dass Darwin selber (zumindest in seiner bahnbrechenden Schrift On the Origin of Species) durchaus teleologisch gelesen werden muss – Darwin stand Lamarck zu Beginn seiner Beschäftigung mit der Evolution viel näher als die heutige Evolutionstheorie. Und wenn Trendelenburg in seiner Darstellung des Darwinismus auf die Pferdezucht zurück greift, so ist auch das nur ein Echo des Umstands, dass Darwin viele Züge der Evolution an Hand der – Taubenzucht vorstellte. Dass bei einer Zucht tatsächlich teleologisch – d.h., mit einem bestimmten Ziel im Auge – vorgegangen wird, und sie deshalb mit der natürlichen Evolution nicht verglichen werden darf, entging offenbar Darwin wie Trendelenburg. Kein Wunder, kommt der deutsche Philosoph im Folgenden dann auf eine Art übernatürlichen Züchter zu sprechen – Gott nämlich, dessen Existenz er (Kants Zurückweisung seinerseits zurückweisend) so halb und halb für bewiesen annimmt.
Die zwischen Darwin und dem lieben Gott liegende Besprechung der eigentlichen Logik (denn ja: es gibt sie in den Logischen Untersuchungen bei aller Wissenschaftsphilosophie doch auch) habe ich übersprungen, weil sie im Grunde genommen nur darin besteht, die Weiterentwicklung des Aristotelischen Syllogismus in der Scholastik ihrerseits einer Prüfung zu unterziehen, dann auch einige der logischen Figuren der mittelalterlichen Denker zurückweisend.
Die Summe seines Denkens finden wir dann auf Seite 454 der dritten Auflage:
Obzwar die Philosophie, wenn wir die Geschichte fragen, in einer Einheit mit den übrigen Wissenschaften entstand, so hat sich doch durch die Theilung der Arbeit dieser Verband längst gelöst, und die Philosophie findet jetzt die einzelnen Wissenschaften in ihrer Zerstreuung und in der Gestalt vor, die sie sich für sich gegeben haben. Die Logik und Metaphysik haben in ihnen ihren Stoff der Betrachtung; sie finden in ihnen Methoden und vorausgesetzte Principien vor und haben die Aufgabe, ihren Ursprung und ihre Einheit aufzusuchen. […] Die Logik und Metaphysik greifen also nicht in die philosophischen Disciplinen vor, sondern in die empirischen zurück.
Wir müssen uns wohl nicht wundern, wenn er in der Folge als Kronzeugen dieser Auffassung von Philosophie – Platon und Aristoteles vorbringt.
Summa summarum stellt Trendelenburgs Philosophie den Versuch dar, eine Philosophie größtenteils gegen und meistens ohne Hegel (oder Herbart, der in der dritten Auflage aber zusehends zum Fußnoten-Lieferant herabgesetzt wurde) zu erstellen, die dennoch dem damals ubiquitären Anspruch eines geschlossenen Systems Genüge tat. Historisch ist Trendelenburgs Versuch als solcher verstaubt; sein Denken hat aber indirekt Folgen getragen, nämlich in Form der Beschäftigung mit den Naturwissenschaften, die wir bei den Neukantianern finden, die zum Teil seine Schüler waren.