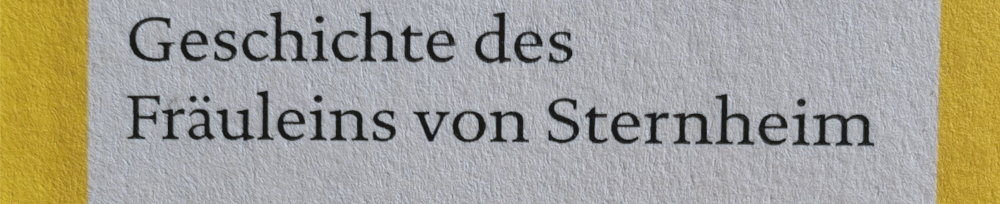Kann man heute die Geschichte des Fräuleins von Sternheim1) noch lesen? Sollte man sie eventuell sogar noch lesen? Bonaventura (der Nachtwächter und Blogger) verneint die erste Frage in seinem Blog-Eintrag zu diesem Roman kategorisch. Ich muss ihm Recht geben: Wenn man den Roman an Hand der heute gültigen Kriterien für qualitativ höher stehende Literatur beurteil, ist er unlesbar. Wortschatz, Stil und Plot sind für Heutige unerträglich. Allerdings stammt Bonaventuras Rezension auch schon aus dem Jahr 2009. Wie, wenn in der Zwischenzeit neue Fakten aufgetaucht sind?
Bevor ich mich dieser Frage widme, aber noch rasch dies: Wenn Bonaventura (der Nachtwächter und Blogger) empfiehlt, den Roman nach dem ersten Buch abzubrechen2), so möchte sich sogar weiter gehen und behaupten, dass man ihn schon nach den ersten rund 50 Seiten (gerechnet in meiner Reclam-Ausgabe) abbrechen kann. Auf diesen wird zwar nur die Vorgeschichte der eigentlichen Geschichte des Fräuleins von Sternheim erzählt: Sternheim, ein Bürgerlicher, hat in militärischen Diensten eines ungenannten deutschen Staats Karriere gemacht und es bis zum Oberst gebracht. Ja, er wurde für seine Verdienste gar in den Adel erhoben. Das ermöglicht es ihm, die älteste Tochter seines Freundes und Gönners zu heiraten. Dieser, aus älterem Adel als er, besorgt ihm auch eine kleine Herrschaft – zwei oder drei Dörfer, Pfarrer inklusive. In dieser kleinen Herrschaft bilden der Oberst und seine Gattin eine Art kleines Utopia. Das Hauptgewicht darin wird auf eine aufgeklärte (Aus-)Bildung auch der unteren Stände und auch von deren weiblichen Mitgliedern gelegt. Alles im Sinne Rousseaus. Zunächst läuft alles gut. Die beiden Sternheims kriegen ein Kind, eine Tochter, die sie Sophie taufen und die die eigentliche Protagonistin des Romans werden wird. Dann stirbt aber die Mutter im Kindbett des zweiten Kindes, eines Sohns. Dieser stirbt mit ihr. Der Vater bleibt nunmehr unverheiratet und stirbt, als Sophie 19 Jahre alt ist. Da auch der väterliche Gönner der Familie gestorben ist, wird Sophie zu einem entfernten Onkel gebracht, dessen Gedankengut mit ihrem von den Eltern übernommen so gar nicht übereinstimmt. Hier können wir abbrechen, denn von hier aus gibt es für die Geschichte eigentlich nur noch zwei Wege: Pamela oder Uncle Silas, Richardson oder Le Fanu. In beiden Fällen aber wird zu erwarten sein, dass nun die Tugend3) der jungen Frau verfolgt wird und in höchster Gefahr schwebt. Da wir bisher aber keine Hinweise auf eventuell übernatürliche Phänomene oder richtig schlimme Bösewichte erhalten haben, können wir getrost schließen, dass das Schicksal des Fräulein von Sternheim mutatis mutandis dasjenige Pamelas erleiden wird. Und wir dürfen getrost ein Happy Ending erwarten – eine weitere Lektüre erübrigt sich.
Die Zeitgenoss:innen Sophie von La Roches nun aber urteilten weniger negativ über den Roman – ja, manche Urteile fielen nachgerade enthusiastisch zu Gunsten des Romans aus. Nicht nur in Briefen, wie zum Beispiel zwischen Herder und der damals noch nicht mit ihm verheirateten Caroline Flachsland oder bei Julie Bondeli. Auch in offiziellen Rezensionen schwärmten die Kritiker. Haller lobt die religiöse Sittlichkeit der Heldin (glaubt aber, das Buch stamme vom als Herausgeber amtierenden Wieland). Merck und Goethe schwärmen ebenfalls von der Heldin. Musäus in Nicolais Allgemeiner Deutscher Bibliothek lobt unter anderem wie folgt:
Allenthalben sind die Situationen so gewählt, wie sie sich zu dieser Absicht [eines hohen inneren Gehaltes – P.H.] und der Lieblingsidee der V. passen, die ihrem Herzen Ehre macht: wohltätig zu seyn und auf alle Weise seinem Nebenmenschen sich nützlich zu machen.
S. 351 meiner Ausgabe
Lenz bemängelt nur die Fußnoten, die der Herausgeber Wieland hinzugefügt hat, als störend4). Und noch Eichendorff schrieb 1851 in Der deutsche Roman:
An der Spitze dieses weiblichen Tugendbundes steht eine brave Frau, die bekannte Sophie von La Roche, von den gleichzeitigen männlichen Tugendbündlern nur durch eine sorgfältige Parure von Empfindsamkeit unterschieden, gegen die jene Biedermänner gerade sehr plump und polternd zu Felde zogen.
S. 357 meiner Ausgabe
Aufklärer, Stürmer und Dränger, Romantiker vereint im Lob dieses Romans, den wir heute als praktisch unlesbar empfinden! Wie das? Das Schlüsselwort gibt uns Eichendorff: Empfindsamkeit. Tatsächlich war diese Art zu denken und zu schreiben via den gemeinsamen Nenner Rousseau bei allen drei Strömungen durchaus positiv konnotiert. Und die Geschichte des Fräuleins von Sternheim konnte um so mehr überzeugen, als Sophie von La Roche selber in ihrer Jugend in einem streng pietistischen Haus aufwuchs und diese kindlichen Eindrücke, die Betonung der Wichtigkeit von weiblicher Tugend (inklusive Verdrängung aller sexuellen Gelüste) in ihren Roman trug. Das war nicht angelesen, das war nicht künstlich imitiertes Gedankengut – es war genuin.
So weit die literaturgeschichtliche Betrachtung. Außer, wir seien an einer sochen interessiert, ist das aber nach wie vor kein Grund, das Buch heute noch zu lesen.
Nun aber wird der Roman von feministischer Seite wieder in den literarischen Parnass erhoben. Nicht nur, weil Sophie von La Roche tatsächlich in der Nachfolge der Louise Gottsched zur bekanntesten und einflussreichsten deutschen Schriftstellerin wurde und als erste eine sehr erfolgreiche Zeitschrift für Frauen lancierte, die mehr als nur Modetipps enthielt. Nicht nur, weil Sophie von La Roche nach Anna Louisa Karsch erst die zweite Frau war, die (zumindest zeitweise) von ihrer schriftstellerischen Arbeit leben konnte. Als ‚role model‘ für heutige Autorinnen ist sie dennoch nur bedingt geeignet. Aber Sophie von La Roche, bzw. ihre Heldin Sophie von Sternheim, liefern zumindest ansatzweise so etwas wie ein feministisches Utopia. Wir müssen zugeben, dass La Roche die Grundidee bereits in der kleinen Herrschaft des Vaters von Sophie vorstellt, und es (außerhalb des Plots) bei Jean-Jacques Rousseau als erstes vorgefunden hat. Aber es gibt einen Moment, wo Sophie von Sternheim, verstoßen von der ganzen Welt, an einem abgelegenen Ort irgendwo in der englischen Provinz, ein paar Dienstmädchen und zwei von ihrem adligen Vater verstoßenen außerehelich geborenen Mädchen Unterricht gibt. Hier, im Pädagogischen, im Unterricht für weibliche Wesen der unteren Klassen, der ihnen mehr beibringt, als was sie für ihren zukünftigen Job brauchen werden: Hier blitzt für kurze Zeit im Roman eine tatsächliche Emanzipation auch im heutigen Sinn auf, und es spricht für die Autorin, dass sie bei ihrem Happy Ending diese Mädchen nicht vergisst, sondern Sophie von Sternheim, nunmehr reich verheiratet, das Experiment, mit diesen Mädchen, aber im Großen, weiterführen lässt. So versucht das ehemalige Fräulein von Sternheim, dasjenige weiter zu geben und zu institutionalisieren, was man ihr nach dem Tod ihres Vaters verwehrt hatte. (Wo man ihr, symbolisch für das Ganze, ihre Bücher wegnahm, und ihr so jede Form von höherer Bildung, und sei sie nur autodidaktisch, verunmöglichte. Und autodidaktische Bildung war, wie Sophie von La Roche selber erfahren hatte, die einzige den Frauen jener Zeit, zumindest manchmal, zumindest theoretisch, mögliche.)
Ob man nun wegen dieser vom Feminismus aufgegriffenen Punkte den Roman von A bis Z lesen soll, muss jede:r selbst entscheiden. Ganz verlorene Lesezeit ist es auch heute nicht.
1) Der Titel wird tatsächlich ohne Artikel zu Geschichte geschrieben, was offenbar auch der Herausgeberin meines Reclam-Büchleins in ihrem Nachwort entgangen ist.
(Hier noch die bibliografischen Angaben zu meiner Ausgabe: Sophie von La Roche: Geschichte des Fräuleins von Sternheim. Von einer Freundin derselben aus Original⸗Papieren und anderen zuverläßigen Quellen gezogen. [Original herausgegeben von Wieland, hier:] Herausgegeben von Barbara Becker-Cantario. Ditzingen: Reclam, 2023. = RUB 7934. [Auf Grund der für Reclam ungewöhnlich langen Lieferfrist tippe ich darauf, dass dieser Backlist-Titel unterdessen als Print on Demand hergestellt wird. Ursprünglich ist das Büchlein erstmals 1983 erschienen.])
2) Er ist damals in zwei Bänden erschienen, wobei zwischen erstem und zweitem Band einige Zeit verstrich, wohl weil der Verleger erst den Erfolg des ersten abwarten wollte.
3)Tugend und tugendhaft sind zwei Wörter, die ungefähr auf jeder Seite mindestens einmal vorkommen …
4) Tatsächlich sind kommentierende Fußnoten eine Untugend Wielands (no pun intended), der er aber auch in seinem Teutschen Merkur freien Lauf ließ, wo er als Herausgeber ebenfalls die Beiträge – egal vom wem sie stammten – mit zum Teil kritischen oder gar den Beiträgern widersprechenden Kommentaren zu versehen pflegte.