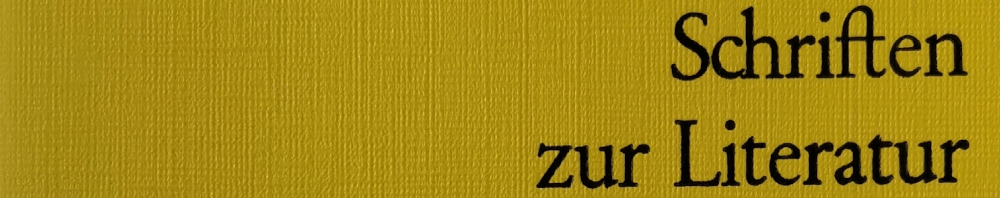Johann Christoph Gottsched war zu seiner Zeit, was man im 20. Jahrhundert dann einen „Literaturpapst“ zu nennen pflegte. Ja, eine Zeitlang war er gar der deutsche Literaturpapst. Und anders als die späteren Literaturpäpste hätte er diese Bezeichnung wirklich mit vollem Recht verdient. Während nämlich die späteren Literaturpäpste ihre Kritiken an Hand mehr oder weniger explizit formulierter, aber vorgefundener Kriterien formulierten, hat Gottsched nicht nur heilig gesprochen oder exkommuniziert wie diese – er legte auch die katholischen (i.e.: allgemein gültigen) Glaubensregeln, also die literarischen Regeln, gleich selber fest, nach denen die Heiligsprechungen und Exkommunikationen durchgeführt wurden, und erzielte damit auch eine große Akzeptanz.
Vor mir liegt ein mit fast 400 Seiten nicht ganz so dünnes Reclam-Büchlein von 1972 mit der Nummer 9361 (mittlerweile offenbar vergriffen – auch die gelben Taschenbücher von Reclam sind nicht mehr, was sie einmal waren …), herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Horst Steinmetz. In diesem Nachwort unterscheidet er eine frühe, eine mittlere und eine späte Phase in Gottscheds literaturtheoretischem Wirken. Entsprechend hat er auch seine Auswahl aus Gottscheds Schriften getroffen. Wir finden natürlich seine bekanntesten Werke darunter: Versuch einer Critischen Dichtkunst vor die Deutschen, die Vorrede zum ‹Sterbenden Cato› (seinem eigenen Drama nämlich) oder die Vorrede zur ‹Deutschen Schaubühne›.
Wenn wir davon ausgehen, dass Steinmetz’ Auswahl auch die typischen Themen einer jeden Schaffensperiode von Gottsched charakterisiert, so sehen wir folgende Entwicklung:
Da ist zunächst der „junge“ Gottsched, der sich vor allem mit dem deutschen Drama auseinander setzt. An Hand der drei Einheiten (von Ort, Zeit und Handlung), die er der Poetik des Aristoteles entnommen glaubte, die in dieser Form aber eine Interpretation des französischen Klassizismus war, dachte er, gute von schlechten Dramen unterscheiden zu können. Dass er die meisten Beispiele guter Dramen im französischen Klassizismus fand, wird nicht erstaunen, war doch in dieser Zeit der Franzose Boileau mit seinem Art poétique sein meistzitiertes Vorbild. Seine ‚bête noire‘, was schlechte Dramen betrifft, war hingegen Daniel Casper von Lohenstein. Der „junge“ Gottsched war da auch völlig dogmatisch und kannte weder Ausnahmen noch Entschuldigungen. Sein Dogmatizismus geht so weit, dass er sogar ein Rezept für ein gutes Drama gibt:
Zuallererst wähle man sich einen lehrreichen moralischen Satz, der in dem ganzen Gedichte zum Grunde liegen soll, nach Beschaffenheit der Absichten, die man sich zu erlangen vorgenommen. Hierzu ersinne man sich eine ganz allgemeine Begebenheit, worin eine Handlung vorkommt, daran dieser erwählte Lehrsatz sehr augenscheinlich in die Sinne fällt.
Versuch einer Critischen Dichtkunst vor die Deutschen, S. 96 meiner Ausgabe
Was Gottsched in seinem Rezept nicht berücksichtigt, ist der Umstand, dass die drei Einheiten in der klassizistischen Formulierung zu Boileaus Zeit nur funktionierten, weil gleich drei geniale Dramatiker sie anwendeten: Corneille, Racine und Molière. Schon Voltaire, den Gottsched noch in höchsten Tönen lobt, erreichte diese drei nicht mehr und seine Dramen sind heute praktisch vollständig aus dem Gedächtnis der literarischen Welt verschwunden.
Diese Zeit- und Ortsgebundenheit von Regeln und Maßnahmen hat aber auch der spätere Kritiker Lessing nicht realisiert, wenn er Gottsched vorwirft, den Hanswurst von der deutschen Bühne gejagt zu haben. Woran Lessing nämlich denkt, wenn er Hanswurst sagt, ist der Zyniker und Misanthrop, den Shakespeare und einige Italiener auf die Bühne gestellt hatten, als einen Kommentator des soeben Gesehenen. Was Gottsched aber eliminierte, war ein undisziplinierter Schweineigel, der – meist ex tempore – obszöne Witze ins Publikum schleuderte und der weder in Wort noch in Tat irgendeinen Zusammenhang hatte mit dem eigentlichen Drama.
So weit zum „jungen“ Gottsched. Der späte Gottsched kämpfte einen anderen Kampf. Die deutsche Bühne hatte – spätestens seit er seinen eigenen Sterbenden Cato darauf gestellt hatte – nun ihre Vorbilder und es gab verschiedene Schauspieltruppen, die dem neuen Credo anhingen. So wandte sich Gottscheds Blick ins Ausland. Dort erschienen nämlich mehr und mehr Texte, die die verschiedenen Literaturen Europas verglichen – wobei die deutsche selten gut wegkam und die betreffenden ausländischen Autoren vom Fachmann Gottsched des öfteren eklatanter Unkenntnis überwiesen werden konnten. Vor allem aber ging es ihm nun darum, den Nachweis zu erbringen, dass die deutsche Literatur den übrigen europäischen Literaturen gleichwertig sei und dass auch die deutsche Sprache nicht nur eine barbarische Ausdrucksform der Unterschicht war. (Was noch ein gewisser Friedrich in Preußen nicht wahr haben wollte.)
Gottsched war nun auch einen Tick toleranter geworden und akzeptierte teilweise Dinge, die der junge Mann noch lautstark kritisiert hätte. Maßstab guter bzw. schlechter Literatur war nun weniger die Einhaltung künstlicher Regeln, sondern die Wahrscheinlichkeit. Damit war keine mathematische Theorie gemeint. Gottsched drückte damit den Gedanken aus, dass gute Literatur immer ‚realistisch‘ sei – will sagen: dass nicht nur die Taten und Worte der Handelnden nachvollziehbar waren, sondern auch die äußeren Umstände logisch verbunden. (Weshalb er zum Beispiel Miltons Pandämonium verurteilte – im Gegensatz zu Bodmer, der hierin Addisons Lob folgte, was Gottsched gleich noch mehr ärgerte.)
Literaturgeschichtlich immer noch relevant, auch in seinem Streit mit Bodmer (den er anfangs noch als Verbündeten sah, je mehr aber der Streit eskalierte, um so mehr strich er in späteren Auflagen seines Versuch einer Critischen Dichtkunst die Hinweise auf den Schweizer). Dass von ihm nur noch sein Sterbender Cato als Reclam-Büchlein erhältlich ist, und über ihn als halbwegs einführendes Werk nur noch das Gottsched Handbuch bei Metzler (und das zum stolzen Preis von CHF 88.00 für ein PDF!), ist meiner Ansicht nach symptomatisch für den Verfall jeden literaturgeschichtlichen Interesses in der deutschen akademisch-literaturwissenschaftlichen Landschaft.