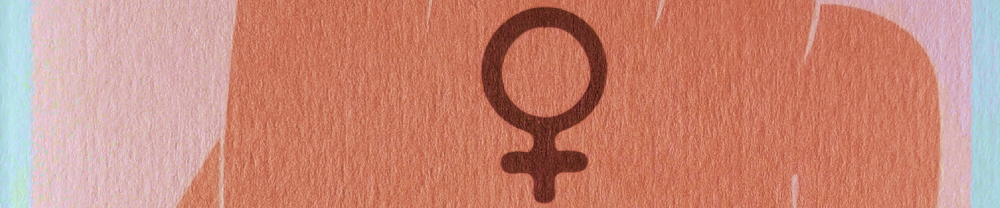[Es ist leider so,] dass die Frauenbewegung auch schuld am miserabelsten ihrer Bücher ist – den streitsüchtigen Three Guineas – und Ursache für eine Reihe weniger guter Passagen in Orlando. […] Sie [Virginia Woolf – P.H.] war überzeugt davon, dass die Gesellschaft für die Männer gemacht sei, dass die Hauptbeschäftigung der Männer darin bestehe, Blut zu vergießen, Geld zu verdienen, Befehle auszuteilen und Uniformen zu tragen und dass keine dieser Beschäftigungen bewunderungswürdig sei. [E. M. Forster in seiner Rede-Lecture von 1941]
Nun gehörte E. M. Forster, eine Zeitlang Mitglied der Bloomsbury Group um Virginia Woolf und ihren Mann, durchaus selber zu einer Gruppe, deren Rechte im damaligen England (und nicht nur dort) arg beschnitten wurde. Ja, es wäre sogar strafbar gewesen, hätte er seine Homosexualität öffentlich zugegeben oder ausgelebt. Da er sie nur im engeren Kreis eingestand, blieb ihm das Schicksal eines Oscar Wilde oder Alan Turing erspart. Dennoch reagiert er hier eindeutig als verletztes Männchen; man ist versucht, auf ihn das Wort vom Glashaus und den Steinen anzuwenden.
Zu Orlando will ich mich hier nicht äußern – ich bin, anders als auch renommierte Literaturkritiken, nicht unbedingt ein Fan davon. Woolf hat bei weitem Besseres geschrieben. Was die Three Guineas betrifft, die heute das Thema sind, gebe ich zu, dass Forsters Zusammenfassung des Inhalts zwar bösartig und holzschnittartig ist, aber im Grunde zutrifft.
Allerdings halte ich das für wenig erstaunlich. Seit der Veröffentlichung von A Room of One’s Own, ihrem bedeutend bekannteren und meist hoch gelobten ersten Essay zum Thema der Situation der Frau in ihrer Gegenwart (will sagen: 1928/29, im England der Zwischenkriegszeit), also neun Jahre vor den Three Guineas, war die Sachlage nunmehr folgende:
Außenpolitisch hatte sich einiges geändert. In Italien und in Deutschland waren die Faschisten an der Macht, in Spanien tobte ein Bürgerkrieg, in dem verhindert werden sollte, dass ein weiterer Faschist die Macht ergreifen könnte. Innenpolitisch hatte sich hingegen gar nichts geändert, vor allem auch an der Situation der Frau nicht. Kein Wunder, hat Woolf das feine ironische Florett des eigenen Zimmers nun vertauscht gegen einen Vorschlaghammer. Ursprünglich sollte schon der Titel des Essay diesen Vorschlaghammer zeigen: On Being Despised, lautete er nämlich. Das war aber für die anderen Verantwortlichen von Hogarth Press, dem Verlag, den Woolf und ihr Mann selber gegründet hatten und in dem Woolf seit langem alle ihre Werke publizierte, zu starker Tobak, und man einigte sich auf Three Guineas – ein Titel, der erst verständlich wird, wenn man das Buch gelesen hat. Als Drei Guineen ist der Essay dann auch, und zwar offenbar erst 2001, auf Deutsch zum ersten Mal erschienen. 2021 brachte der Zürcher Kampa-Verlag die (eine neue?) Übersetzung von Antje Rávik Strubel heraus, bei dem nun auch der ursprünglich angedachte Titel Virginia Woolfs zu Ehren kommt. (Selbst fürs englischsprachige Publikum sind die Guinees im Titel unterdessen wohl erklärungsbedürftig. Diese Münze gibt es seit langem nicht mehr offiziell. Seit der Umstellung des britischen Pfund auf eine Dezimalwährung gilt, glaube ich, ein Umrechungskurs von einer Guinea = rund zwei Pfund. Das ist heute nicht mehr viel, stellte zu Woolfs Zeit aber noch eine nicht unbeträchtliche Summe dar.)
Formal gesehen, handelt sich beim Text um einen Brief, einen Antwort-Brief genauer, den Virginia Woolf an einen Anwalt schreibt. Dieser hat ihr vor drei Jahren, heißt es gleich im ersten Satz, einmal einen Brief geschrieben, in dem er sie um Unterstützung für einen pazifistisch orientierten Verein bat – finanzielle Unterstützung wie auch wenn möglich gleich Beitritt zum Verein. Drei Jahre, schreibt Woolf, habe sie den Brief liegen lassen, weil sie nicht wusste, wie antworten. Um aber zu einer Antwort zu finden, erzählt sie dem Anwalt von zwei anderen Briefen, die sie ebenfalls vor längerem erhalten habe. Beides Briefe, die um Unterstützung bitten, finanzielle wie durch persönlichen Einsatz. Die beiden anderen Briefe stammen von Frauen. Die eine ist Schatzmeisterin eines Frauen-College in Cambridge, die andere Schatzmeisterin eines Vereins, der sich für mehr und bessere Arbeit für professionelle Frauen einsetzt. Zu den Briefen der beiden Frauen lassen sich Vorbilder finden im Briefwechsel Woolfs, zu dem des Anwalts meines Wissens nicht. Woolf nun beantwortet im vorliegenden Essay die Bitte des Anwalts, indem sie zuerst die Bitten der beiden Frauen vorstellt und – innerhalb des Briefes an den Anwalt – deren Briefe ebenfalls beantwortet. Zum Schluss erhält jede/r der drei Bittstellenden eine Spende von je einer Guinea …
Vereinfacht gesagt, verbindet Woolf im vorliegenden Essay den Einsatz für Pazifismus mit der wirtschaftlichen Lage der Frauen in England. (Sie spricht immer von England, ihre Beispiele betreffen aber, wenn ich das richtig sehe, das ganze Königreich.) Sie beschränkt sich auf die Schicht, aus der sie selber stammt, die Schicht der Töchter aus gebildetem Haus, wie sie es nennt. Mit verschiedenen Argumenten, die sich zum Teil wiederholen, dabei aber verfeinert werden, umreißt sie die Lage dieser Frauen. Während in diesen gebildeten Häusern quasi Fonds geäufnet werden für die Ausbildung des Sohns / der Söhne (Woolf nimmt ein Beispiel aus einem Roman Thackereys), können die Töchter froh sein, wenn ihnen der Vater ein paar Deutsch-Lektionen spendiert. Und wenn die Söhne später in die Öffentlichkeit gehen, können die im Haus bleibenden Töchter froh sein, wenn sie jährlich 40 £ Taschengeld kriegen. Dieses Beispiel nimmt sie aus einer Biografie einer Autorin, die man hierzulande nicht mehr kennt. Will sagen: Eine systematische Ausbildung, eventuell sogar an einer renommierten Universität, ist den jungen Frauen verwehrt, auch noch im Jahr 1938.
Anders als die großen Universitäten und deren Colleges, die immer wieder Legate und Spenden in beträchtlicher Höhe erhalten, darbt das Frauen-College. Das zeigt der erste Brief. Und selbst wenn die jungen Frauen dort eine Ausbildung gemacht haben, haben sie keinen Abschluss vorzuweisen, denn ein Bachelor-Titel darf nur verliehen werden, wenn die Lehrenden selber einen solchen Titel haben. Über einen solchen verfügen die lehrenden Frauen am Frauen-College aber nicht. Wie denn auch? In die Männer-Colleges dürfen sie sich nicht einschreiben, und das Frauen-College darf ihnen keinen Titel verleihen …
In ihrem Brief an den Anwalt spielt Woolf denn auch immer mit ihrer Situation, indem sie als ihre einzigen Quellen welche heranzieht, die in öffentlichen Bibliotheken zugänglich sind. (Denn die Universitätsbibliotheken sind den Frauen auch neun Jahre nach dem eigenen Zimmer immer noch verwehrt.) Das sind vor allem ein statistisches Jahrbuch und Autobiografien verschiedener als Schriftstellerin tätiger Frauen.
Wenn in der öffentlichen Verwaltung alle gut bezahlten Stellen Männern vorbehalten sind, die sich gegenseitig in pompösen öffentlichen Auftritten feiern, bekleidet mit (in Woolfs Darstellung) lächerlichen Kostümen und seltsamen Insignien, wenn damit auch die Macht im Staat den Männern vorbehalten wird – wen wundert’s, dass Woolf tatsächlich auch in ihrer Heimat eine weit verbreitete toxische Männlichkeit vorfindet. Diese Männer, die sich auf ihre Macht so viel einbilden, die den Krieg als männliche Tugend betrachten und als Charakter bildend, sind sie so verschieden von denen, die gerade in Italien und Deutschland zu finden sind? Woolf selber sieht in den Fotografien aus dem Spanischen Bürgerkrieg, die vor ihr liegen, so gar nichts Heroisches und den Charakter Bildendes. Ihre Analyse betrifft auch bekannte Dichter. Thomas Carlyle hat seine öffentlichen Auftritte genossen; seine Frau (Jane Welsh) langweilte sich unter den paradierenden Pfauen. Wordsworth wurde berühmt, seine Schwester blieb die unbekannte Zudienerin, obwohl er viel aus ihren Notizen wörtlich übernommen hat.
Es würde, meinte Woolf zum Schluss resigniert, wohl noch weitere hundert oder zweihundert Jahre dauern, bis die Frauen wirklich gleiche Rechte, gleiche Ausbildung und gleich viel Geld hätten wie die Männer.
Heute ist die Situation nicht mehr dieselbe. Woolf, Kind des viktorianischen Zeitalters, erlebte noch Zwänge, die heute nicht mehr existieren. Zumindest in der Theorie und in der westlichen Welt stehen den Frauen heute alle Stellen und alle Universitäten offen. Dennoch sind die Löhne der Frauen selbst hier immer noch tiefer als die ihrer männlichen Kollegen und im Spitzenmanagement ist ihr Anteil immer noch gering. Es sind seit Woolfes Essay nun rund einhundert Jahre vergangen. Ich fürchte, es wird noch einmal ein Säkulum vergehen müssen, bis die Frauen einigermaßen gleichgestellt wind. Ob allerdings, wie Woolf impliziert, Frauen eine pazifistischere Politik machen werden, bleibt zu bezweifeln.
Summa summarum ist Woolfs Essay heute wichtiger denn je. Sicher, er beschäftigt sich mit einer immer noch relativ privilegierten Klasse. Man hat Woolf denn auch vorgeworfen, die Frauen aus der Arbeiterklasse nicht zu erwähnen. Das ist aber eine logische Konsequenz daraus, dass sie ja keinen Zugriff auf andere Quellen außer ihren eigenen häuslichen hat, und war von Woolf wohl beabsichtigt. Sie war keine feministische eierlegende Wollmilchsau.
Wir aber sollten wieder mehr Woolf lesen. Weil die Weltpolitik gerade wieder in eine faschistische und toxische Männlichkeit umschlägt. Und weil auch hundert Jahre nach den Drei Guineen die Frauen noch immer nicht gleichberechtigt sind.