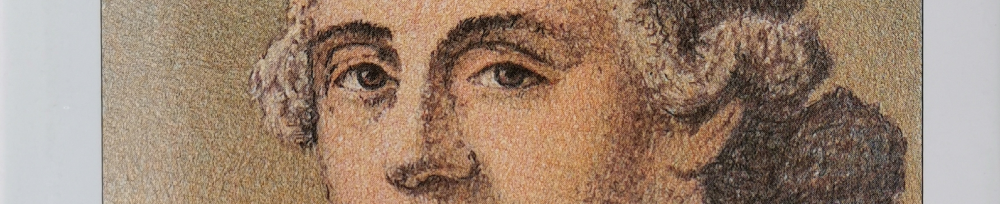Sie waren schon eine Bande frecher Jungs, die Stürmer und Dränger, als sie – so um 1775 herum – begannen, die deutsche Literatur aufzumischen. Es ist durchaus gerechtfertigt, dass wir in der Geschichte der deutschen Literatur diese Epoche separat aufführen, als eine Art Zwischenstufe, welche Aufklärung und Empfindsamkeit, die ablaufende Zeit, verbinden sollte mit der Klassik bzw. Romantik, der erst noch kommenden Zeit, deren Pochen diese Jungs schon spürten. Das Philister-Bashing der Romantiker zum Beispiel wäre ohne entsprechende Vorläufer im Sturm und Drang nicht möglich gewesen.
Und genau so einen Vorläufer haben wir mit J. M. R. Lenz’ Pandaemonium Germanicum vor uns. Wobei dieser Vorläufer selbst wieder ein Nachläufer ist. 1775 entstanden (allerdings erst nach seinem Tod, 1819, zum ersten Mal veröffentlicht) nimmt Lenz’ dramatische Skizze Thematik und Rhetorik des zwei Jahre älteren Götter, Helden und Wieland seines Busenfreundes Goethe wieder auf. Allerdings war Goethe schon damals ‚klassischer‘ als Lenz; seine Farce Götter, Helden und Wieland orientiert sich an den Totengesprächen Lukians. (Manchmal nimmt die Literaturgeschichte seltsame Wendungen: Goethe konnte 1773 noch nicht wissen, dass sich Wieland ein paar Jahre später einer Übersetzung von Lukians Gesamtwerk widmen sollte, die bis heute maßgebend ist.)
Lenz seinerseits lässt die Handlung ebenfalls an und auf einem klassischen Ort stattfinden – am Helikon, dem antiken Sitz der Musen. Jede Menge Autoren und ein paar Autorinnen drängen sich an dessen Fuß und möchten ihn gern besteigen, aber niemand kommt auch nur über die ersten paar Schritte hinaus. Unter den Musenverehrern ist auch Lenz selber. Bei ihm ist es ein wenig anders. Er schafft es wenigstens halbwegs, zu den Musen aufzusteigen. Mühsam und langsam nämlich kriecht er auf allen Vieren den Berg hoch. Er trifft dabei auf Goethe, der mühelos hoch hüpft. Goethe ist halt hier geboren, muss Lenz zugeben. Irgendwie, auch mit Hilfe seines Freundes, schafft es Lenz dann doch auf den Berggipfel, wo das Pandaemonium erst losbricht. Vor allem die Dichter des tändelnden Rokoko-Geschmacks (zu denen Lenz auch Wieland zählt) wird – zum Teil in physischen Aktionen, die an die volkstümlichen Hanswurstiaden erinnern – der Garaus gemacht. So wird Goethe gezeigt, wie er Wieland an den Haaren zieht. Auch die sich an der französischen Dichtkunst orientierenden Autoren kommen bei Lenz schlecht weg. Lenz’ eigene Positionierung zur französischen Literatur ist dabei zwiespältig. Voltaire betrachtet er als alten, sich selber überlebt habenden Dichter – in dessen Streit mit Rousseau schlägt er sich auf die Seite des Genfers. Dem französischen Theater stellt er Shakespeare gegenüber, macht aber eine Ausnahme für Molière. Ebenso hat ein Rabelais für ihn Vorbildfunktion, was wohl in der grobianisch-genialischen Attitüde von dessen Gargantua und Pantagruel begründet ist. Aber auch Jean de La Fontaine wird positiv dargestellt – er galt dem Livländer wohl als Kritiker der barocken Gesellschaft seiner Zeit.
Auf der anderen Seite kann Lenz wieder erzkonservativ sein. Er macht sich in seinem Stück zwar auch über einen Pfarrer lustig, warnt aber gleichzeitig durch die seinen Namen tragende Figur vor dem Atheismus, ja, er fordert eine ungebrochene Ausrichtung auf einen christlichen Gott. Auf der anderen Seite bezeichnet er die Orthodoxie als kulturfeindliche Borniertheit. Hierin trifft er sich wieder mit dem Pietismus und damit der Empfindsamkeit, deren literarische Vertreter er gleichzeitig angreift. Er entwickelt so eine sehr eigene Poetik. Für ihn ist der Dichter als Genie das Sprachrohr einer biblischen Wahrheit.
Im Übrigen können wir feststellen, dass Lenz in dieser Skizze seine eigene Position in Bezug auf Goethe recht gut erfasst hat. Goethe ist das eigentliche Originalgenie des Sturm und Drang. Er selber, Lenz, ist allenfalls ein Genie – einer, der mit viel Mühe dorthin kommt, wo Goethe mit ein paar Sprüngen landet, und auch dieses gelingt Lenz nur, weil ihm Goethe dabei hilft. Doch Lenz‘ Liebe zu Goethe ist unendlich.
Hierher gehört dann auch, dass Lenz auf eine Veröffentlichung seiner Skizze verzichtete. Goethe hatte sich kurz nach Götter, Helden und Wieland mit eben diesem Wieland versöhnt und wollte wohl die Geduld des Alten in Weimar nicht noch einmal auf die Probe stellen – zumal das damalige Publikum bei den meist anonymen Veröffentlichungen oft genug Mühe bekundete, die Werke der Stürmer und Dränger dem richtigen Urheber zuzuschreiben.
Was bleibt, ist ein Husarenritt durch die damalige Literatur. Und die Feststellung, dass die Romantiker, die wenig später Ähnliches gegen die Weimarer Klassik in Szene setzten, letzten Endes auch hierin doch nur deren Nachfolger waren. (Was wiederum durchaus rechtfertigt, dass die französischen und englischen Versionen einer Geschichte der deutschen Literatur oft die ganze Entwicklung von ca. 1775 bis ca. 1832 unter dem Begriff „Romantik“ subsumieren.)
Kein ganz großes Stück Literatur vielleicht. Aber durchaus witzig und interessant, wenn man sich in der Zeit ein wenig auskennt.