Machado de Assis ist heute im deutschen Sprachraum sicher bekannter, als er es vor 20 Jahren noch war, zu jener Zeit, da ich ihn für mich entdeckte. Das mag, wie es der Verfasser des Nachworts der vorliegenden Auswahlausgabe, Manfred Pfister, meint, damit zusammenhängen, dass Brasilien in diesen letzten Jahren zwei Mal Gastland der Frankfurter Buchmesse war; ich weiss es nicht. Aber Joaquim Maria Machado de Assis ist immer noch unbekannt genug, dass man dem deutschsprachigen Publikum einen Gefallen tut, wenn man eben nur eine Auswahl aus seinen insgesamt 7 Erzählbänden1) bringt, statt einen oder gar alle in der Form, in der sie der Brasilianer seinerzeit veröffentlichte.
Wenn Salman Rushdie (gem. Klappentext und Nachwort) behauptet haben soll:
Hinter García Márquez steht Borges und hinter Borges als Quelle und Ursprung von allem Machado de Assis.
so kann man das mit dem Manfred Pfister ein wenig übertrieben finden, aber selbst Pfister muss zugeben, dass Alberto Manguel (in der Geschiche des Lesens) wohl Recht hat, wenn er meint, dass Machado de Assis die brasilianische Literatur praktisch im Alleingang zum modernen Realismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts geführt hat. Beeinflusst u.a. von Sterne, fand er zu einem oft satirisch unterlegten Ton. Seine Geschichten handeln – sofern sie nicht in einem erfundenen Märchenreich spielen – meist in Brasilien, ja in Rio de Janeiro. Der Autor selber war zeit seines Lebens kaum aus Rio de Janeiro (damals noch Hauptstadt Brasiliens) herausgekommen, und gar nie aus dem Land selber. Um so erstaunlicher die grosse Verwandtschaft zwischen Machado de Assis‘ Schreiben und dem eines andern – im deutschen Sprachraum ebenfalls viel zu wenig bekannten – Amerikaners, seines Zeitgenossen aus den USA, Ambrose Bierce. Auch wenn zumindest Assis ein Vielleser war – was sich auch in seinen Kurzgeschichten ausdrückt – haben die beiden wohl nie von einander gehört. In der Realität verankerte, (alp-)traumhafte Geschichten sind beider Markenzeichen. Womit auch bestätigt wird, dass Rushdie mit seiner Genealogie des magischen Realismus zumindest eine Teilwahrheit ausgesprochen hat.
Was auffällt (und auch im Nachwort thematisiert wird), ist der Umstand, dass in allen Kurzgeschichten Machado de Assis‘ das Thema der Rassendiskriminierung nirgends angesprochen wird. Der Autor war selber Enkel eines schwarzen Sklaven, und seine afrikanischen Wurzeln zeigten sich durchaus in seinem Äusseren. Er machte dennoch Karriere, gründete u.a. die Brasilianische Akademie der Literatur und wurde deren erster Präsident. Aber Brasilien war wohl noch nicht wirklich bereit für eine Aufarbeitung des Themas, wie es dann erst runde 100 Jahre später von João Ubaldo Ribeiro in Viva o povo brasileiro zu einem Nationalepos gestaltete.
Das babylonische Wörterbuch enthält 13 Kurzgeschichten, ausgewählt aus den unten angegebenen Erzählbänden, übersetzt von Marianne Gareis und Melanie P. Strasser, mit einen Nachwort versehen von Manfred Pfister und erschienen dieses Jahr in der neuen Manesse-Bibliothek der Weltliteratur. Das reicht allemal als Appetithäppchen, um das Publikum auf mehr von diesem ‚Vater der brasilianischen Literatur‘ neugierig zu machen, zumal die Übersetzungen flüssig und eingängig sind.
1) Contos fluminenses (1870), Histórias da Meia-Noite (1873), Papéis Avulsos (1882), Histórias sem Data (1884), Várias Histórias (1896), Páginas Recolhidas (1899), Relíquias da Casa Velha (1906).

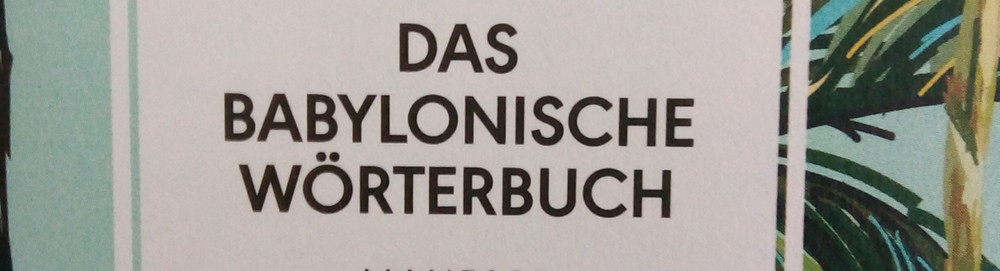
1 Reply to “Joaquim Maria Machado de Assis: Das babylonische Wörterbuch”