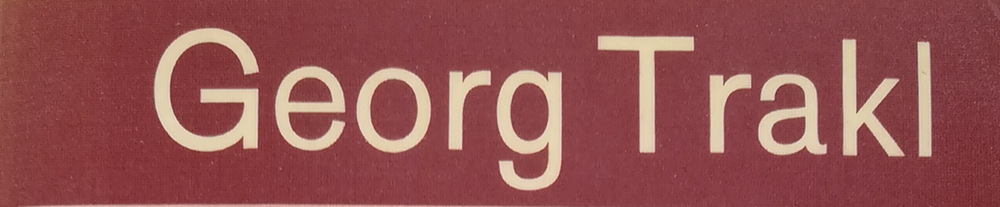Er war der Autor, der mir als erster vorzeigte, was deutschsprachige Lyrik sein konnte. Es sind seit meiner ersten Trakl-Lektüre viele Jahre ins Land gezogen, und natürlich sind unterdessen auf meiner Liste weitere großartige LyrikerInnen hinzugekommen. Aber noch immer gehört Georg Trakl zu jener Handvoll, die ich als Genre-definierend empfinde – zu den Besten seiner Art also.
Dabei geht Trakl mit seinen sprachlichen Utensilien sehr sparsam um. Zu Beginn seines Dichtens hielt er sich meist noch an überlieferte lyrische Formen, wie z.B. das Sonett. Das wurde später ein bisschen anders. Ein paar Dinge finden sich immer wieder in seinen Gedichten; ich nenne sie gerne die ‚Tricks‘ des Autors.
Einer seiner ‚Tricks‘ besteht in der Personalisierung von Naturereignissen wie Gewittern und Feuersbrünsten. Ein anderer im intensiven Gebrauch von Farb-Adjektiven. Ich bin versucht, von einem synästhetischen Gebrauch zu reden, weil bei Trakl nicht nur konkrete Gegenstände eine Farbe aufweisen, sondern auch nicht-sichtbare Entitäten wie ein Schrei, der bei ihm eben nicht ‚laut‘ oder – mit einem ein bisschen erweiterten Vokabular – ’schrill‘ ist. Er kann auch ‚gelb‘ sein. Auch weiß Trakl wie ein Maler darum, dass die Farben, die wir als Otto und Agathe Normalgucker zu sehen vermeinen, nicht unbedingt die Farben sind, die das Objekt in Tat und Wahrheit aufweist. Wir nennen ein Objekt ‚weiß‘, weil wir wissen, dass es an der grellen Sonne praktisch alles Licht zurückwirft, also ‚weiß‘ ist. Deshalb nenen wir es auch im Schatten ‚weiß‘. Dort aber ist es – je nach Umgebung – eher gelb oder blau (worüber sich Goethe in seiner Farbenlehre des Langen und des Breiten auslässt), oder eben auch mal wie eben häufig in den Gedichten Trakls ‚braun‘ oder ‚bräunlich‘. Nur schon der Gebrauch von ’synästhetischen‘ bzw. ‚malerischen‘ Farb-Adjektiven macht, dass sich für uns die Landschaft, in die Trakl seine Leserschaft setzt, fremd anmutet.
Es kommt hinzu, dass wir zwar ein lyrisches Ich vor uns haben – die Szene seiner Gedichte ist immer von einem ganz bestimmten Standpunkt aus geschildert – sich dieses Ich aber nicht immer offen nennt. Als Leser stehe ich somit vor einer subjektiven Welt, die sich aber objektiv gibt. Brecht würde einen ähnlichen ‚Trick‘ später den Verfremdungseffekt nennen und sich alle Mühe geben, ihn auf der Bühne darzustellen. (Ich komme noch auf Trakls Dramen.) Wenn sich das Ich aber nennt, ist es ein passives, rein beobachtendes Ich. So oder so wirkt das Gedicht dadurch auf mich als Leser wie eine Traumsequenz, die ich beobachte, ohne einzugreifen. (Ohne auch nur auf den Gedanken zu kommen, eingreifen zu wollen!)
Last but not least die Landschaft jenseits der Farbgebung. Wir befinden uns mit Trakls Poesie immer in einer archaischen Landschaft. Allenfalls Pferde oder Schafe existieren darin; die Menschen, die auftauchen und wieder verschwinden, sind Reiter, Bauern oder Hirten, Huren und – immer wieder – die Schwester. (Viele InterpretInnen wollen darin einen Hinweis sehen, auf eine inzestuöse Verbindung zwischen Georg Trakl und seiner Lieblingsschwester Gretl. Außer einer voyeuristischen Erregung für die Interpretierenden trägt das aber nicht weiter zum Verständnis der Gedichte bei, weshalb ich es bei der Feststellung eines gehäuften Auftretens der Schwester belasse.) Archaisch ist die Landschaft auch sonst: Wälder, Hügel, alte Gebäude. Anders als bei den meisten seiner expressionistischen Kollegen spielen die moderne Technik (Eisenbahn, Automobil) oder die Großstadt keine Rolle bei Trakl. Man hat ihn deshalb auch schon statt zum Expressionismus zum Symbolismus zählen wollen, und dazu Einflüsse von Rimbaud oder Baudelaire geltend gemacht. Aber auch diese sind Großstadt-Dichter – weshalb es bei einer Einzigartigkeit Trakls bleibt. (Die auch Ludwig Wittgenstein fühlte, als er eine Summe Geldes an Ludwig von Ficker, den Herausgeber der Zeitschrift Der Brenner überwies, mit dem ausdrücklichen Wunsch, einen Teil davon Trakl zukommen zu lassen. Er verstehe seine Texte zwar nicht, sei aber überzeugt, einen ganz großen Dichter vor sich zu haben.) Eher schon verwandt als mit den Franzosen – wenn man denn Verwandtschaftsbeziehungen zwischen LyrikerInnen aufbauen will – ist er mit Hölderlin (den er immer wieder, ohne ihn zu nennen, zitiert) oder mit Novalis und Else Lasker-Schüler, denen beiden er Gedichte gewidmet hat. (Wie übrigens auch Karl Kraus …)
In meiner Ausgabe sind neben den Gedichten auch Prosatexte zu finden – Prosatexte, die aber von Rhythmus und Inhalt her im Grunde genommen nicht typografisch geformte Lyrik darstellen. Zwei oder drei Rezensionen sind minderwertige Auftragsarbeit. Zwei (zwei!) Aphorismen – je nun. Am interessantesten sind noch die paar Dramenfragmente, die einerseits ganz klar zeigen, dass Trakl von den Anforderungen einer Bühne an den Text keine Ahnung hatte (selbst wenn er mehr als nur Fragmente erstellt hätte: man hätte seine Dramen nicht aufführen können, weil letzten Endes alles nur innere Monologe waren, die die Protagonisten sich gegenseitig hielten) – und dass er offenbar zum Zeitpunkt der (versuchten) Abfassung seiner Dramen sehr vom Mythos des über Leichen gehenden Frauenhelden besessen war. Wenn sein Held nicht Don Juan heißt, nennt er ihn Blaubart. Alles in allem aber schwebt Trakl in dramaticis irgendwo zwischen Expressionismus einerseits, Sturm und Drang andererseits.
Fazit: Trakls Lyrik sollte man tatsächlich gelesen haben, auch wenn ich weiß, dass solche Imperative leidig sind. Den Rest kann man ebenso wie den meiner Ausgabe beigefügten kritischen Apparat bei Seite lassen.
Weil wir’s gerade von meiner Ausgabe haben – ich lese Trakl seit Jahren in folgendem Taschenbuch:
Georg Trakl: Das dichterische Werk. Auf Grund der historisch-kritischen Ausgabe von Walter Killy [den über Trakl referieren zu hören ein Genuss war!] und Hans Szklenar. Redaktion sowie Zusammenstellung und Bearbeitung des Anhangs durch Friedrich Kur. [Letzteres meint hier, dass Kur den kritischen Apparat der Ausgabe von Killy und Szklenar nur für ausgewählte Gedichte und auch dann nur in abgespeckter Form bringt. Das ist in Ordnung so – selbst mich, der ich so etwas mal studiert habe, interessiert das heute nicht mehr.] München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 31974. [1. Auflage: 1972 – Das Taschenbuch ist als N° 6001 in der dtv Text-Bibliothek erschienen. Meines Wissens wird diese Ausgabe nach wie vor bei dtv aufgelegt, wenn auch wohl in einer anderen Reihe.]