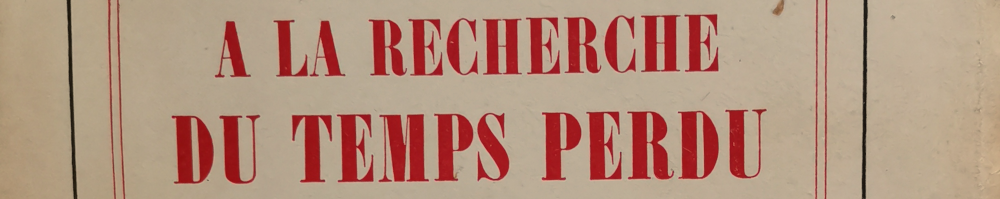Manchmal beschleicht mich der Verdacht, dass Marcel Proust bei der Abfassung der letzten drei Bücher der Suche nach der verlorenen Zeit ein wenig (wie die Wiener sagen würden) gehudelt hat. Die Titel der Bücher passen nicht unbedingt zum Inhalt bzw. er erzählt Dinge, die eigentlich weder zum Titel noch zum Rest des Buchs so ganz passen. Das ist in Anbetracht seiner gesundheitlichen Situation verständlich, und er ist ja auch so noch über der Schlussredaktion von Buch VI gestorben. Schauen wir uns den Anfang des VII. und letzten Buchs einmal an:
Da ist (eigentlich sogar in der ganzen ersten Hälfte, den ersten beiden Kapiteln (von insgesamt nur drei, das letzte ist also alleine so lang wie die beiden anderen)) keine Rede – weder explizit noch implizit – von einer wiedergefundenen Zeit. Im Gegenteil: Das Buch setzt ein mit einem Besuch des Ich-Erzählers auf dem Landsitz der Guermantes bei Combray, wo sich gerade seine ehemalige Jugendliebe Gilberte, aktuell verheiratete de Saint-Loup, aufhält. Wohl betrachtet er am Horizont die Kirche von Combray, wohl erfährt er sogar, dass die beiden für ihn als Kind völlig geschiedenen Teile der Seite von Swann und der Seite der Guermantes sogar ein Weg verbindet, seit jeher verbunden hat. Aber dieses Symbol dafür, wie im Verlauf der Suche nach der verlorenen Zeit die (gross-)bürgerliche und die (hoch-)adlige Schicht der französischen Gesellschaft verschmelzen, in einander übergehen, kommt spät im Roman. Zu spät eigentlich – wir befinden uns ja gerade bei Gilberte, die diese Verschmelzung in Person repräsentiert.
Proust verlässt dieses Thema auch ziemlich rasch. Der Ich-Erzähler geht noch einmal kurz auf die Metamorphose seines Freundes Saint-Loup ein, der seine Frau mehr und mehr zu Gunsten seiner homosexuellen Neigungen vernachlässigt – aber auch darüber hat er sich (vor allem in Buch VI) schon mehrere Male geäußert. Interessant sind erst die literatur- und kunsttheoretischen Diskussionen, die er (zum Teil mit Gilberte – an Hand eines Textes von Balzac –, zum Teil mit sich selber) führt. Was ist Kunst? Was kann sie? Was sind ihre Voraussetzungen? Der Ich-Erzähler liest einen nicht-veröffentlichten Ausschnitt aus den Tagebüchern der Goncourts. Wahrscheinlich ist es Edmond, der schreibt, denn Proust bzw. der Ich-Erzähler verwendet den Namen ‚Goncourt‘ meist mit einem Pronomen im Singular. Das heißt: Natürlich erzählt nicht Goncourt selber, weder Edmond noch Jules, sondern es ist Proust, der in einem herrlichen Pastiche deren Stil adoptiert und in allen ihren selbstverliebten Details eine frühe Abendgesellschaft bei Mme Verdurin schildert. Es wird nachgezeichnet, mit welcher Liebe die beiden Brüder Äußerlichkeiten wie Geschirr, Tapeten etc. solcher Anlässe schilderten – der Liebe nämlich, die Neu-Reiche (bzw. im Falle der Goncourts Neu-Adlige) für Objekte ständischer Repräsentation haben. Der Ich-Erzähler schließt deprimiert, dass er nie diese Beobachtungsgabe für Details gehabt habe wie die Goncourts, dass ihm auch die Natur nichts sage und dass er deshalb gescheiter auf seine schriftstellerischen Ambitionen Verzicht leisten sollte. Was er denn auch tut. Das Herrliche an diesem Pastiche ist nun, dass der Schriftsteller Proust gerade bewiesen hat, dass er durchaus in der Lage war, solche Details zu beschreiben (wenn auch erfundene – weder gab es die Verdurins in dieser Form, noch waren die Goncourts je bei ihnen zu Gast), er sich also selber widerlegte, wenn wir davon ausgingen, dass wir eine Art Autobiografie oder einen Schlüsselroman vor uns hätten. (Was beweist, dass wir mehr als das vor uns haben.)
Im zweiten Kapitel dann – hier könnten wir tatsächlich von so etwas wie einer wiedergefundenen Zeit sprechen – wird der Ich-Erzähler von seinen Ärzten zu einem Aufenthalt unbestimmter Dauer in einem Sanatorium verknurrt. Zwei Mal kommt er in dieser Zeit aber zurück nach Paris. Für diese beiden Aufenthalte in der Stadt gibt Proust als Jahreszahl das Jahr 1916 bzw., weil er den ersten Aufenthalt nach dem zweiten erst erwähnt, 1914. Das ist, wenn ich das richtig sehe, das einzige Mal, dass Proust die Ereignisse in der Suche nach der verlorenen Zeit mit einer Jahreszahl fixiert – insofern haben wir in Kapitel II wirklich die Zeit wiedergefunden. Selbst als Dreyfus-Affäre aktuell war, fanden wir als präzisesten zeitlichen Hinweis den auf den Prozess gegen Zola – und da mussten wir selber herausfinden, wann der genau stattgefunden hatte.
Mit dem Weltkrieg aber ändert sich das – und nicht nur das, wie der Ich-Erzähler feststellt. So sind die ehemaligen Dreyfusards, die damals als Staatsfeinde galten, nunmehr die Erhalter des Staates, die größten Patrioten, während ihre Gegner (vor allem der Hochadel) sich auf der eher zurückhaltenden Seite befinden. Kein Wunder, ist der Hochadel doch durch Verwandtschaftsverhältnisse international verbunden. Exemplarisch für dessen Haltung zeigt Proust uns den Baron de Charlus, der mehr oder weniger offen mit den Deutschen sympathisiert, weil ihn Kaiser Wilhelm II. seinen Cousin nennt. Auch mit Franz Joseph I. ist er verwandt. Verwandtschaft bedeutet nicht große Liebe – Proust bringt als Beispiel der komplizierten Gefühlslage des Hochadels die Kritik und Frotzelei, die der französische Adel an den Romanows übte, um dann, als die Russische Revolution das Zarenhaus wegfegte, in ehrlicher Trauer da zu stehen.
Ansonsten aber ist die Gefühlslage der französischen Bevölkerung klar. Alle sind patriotisch, ja nationalistisch gesinnt und erwarten von Tag zu Tag einen endgültigen Erdrutschsieg Frankreichs in den nächsten zwei Wochen. Selbst der Ich-Erzähler kann nicht anders, als von einer falschen und einer richtigen Seite zu reden. Die richtige ist selbstverständlich die französische, und anders als in der Dreyfus-Affäre gibt der Ich-Erzähler diesmal auch seine Position zu erkennen: Selbstverständlich ist auch er auf der ‚richtigen‘ Seite.
Im Übrigen aber – auch wenn er sich so politisch äussert wie in der ganzen Suche bisher nicht – interessiert den Ich-Erzähler der Krieg mehr, insofern er seine Auswirkungen auf Paris sieht. Nicht nur die nächtlichen Verdunkelungen (weil regelmäßig deutsche Flugzeuge und Zeppeline über der Stadt fliegen, um verschiedene Ziele zu bombardieren) sind interessant. Auch die Auswirkungen des Kriegs auf die Damenmode schildert er ausführlich. Ebenso aber auch persönliche Veränderungen: Saint-Loup, der als Offizier an der Front noch einmal ein anderer wird, bedeutend intellektueller als bisher, der aber dann für seine Mannschaft an der Front stirbt; die Bedienstete Françoise, die – ansonsten Skeptikerin bei alles Aussagen ihres Herrn – tapfer an den Sieg in vierzehn Tagen glaubt, und das seit Jahren; aber auch Charlus.
Der ist mit seinen aristokratischen und ästhetischen Ansichten nicht nur ein Relikt aus vergangenen Zeiten (das wird im zweiten Teil des letzten Buchs wichtig werden). Es ist bei ihm auch so, dass seine homosexuellen Neigungen nun ganz zum Vorschein kommen, auch ‚die Gesellschaft‘ nunmehr darüber im Bilde ist. Was sie nicht weiß, und was der Ich-Erzähler nur zufällig erfährt, weil er nach einem nächtlichen Spaziergang mit eben diesem Charlus sich in einem ihm unbekannten Stadtteil wiederfindet, müde und durstig nach einem offenen Gasthaus oder Hotel sucht und eines findet, das eben eigentlich keines ist, sondern ein Bordell für Homosexuelle, dort eintritt, tatsächlich sogar ein Zimmer zugewiesen erhält, wo er einen Saft trinken kann, dazwischen aber die Unterhaltung der übrigen ‚Gäste‘ überhört hat und sich nun für den ‚Mann in Ketten‘ auf Zimmer 43 interessiert, das Zimmer sucht und findet, durch ein speziell angebrachtes Guckloch hineinschaut und Charlus sieht, nackt und mit Ketten ans Bett gefesselt, während ihn ein Unbekannter auspeitscht – was er also erfährt, dass Charlus nicht nur homosexuell veranlagt ist, sondern auch masochistisch (Proust bzw. der Ich-Erzähler verwenden das Word sadique, offenbar war die Venus im Pelz noch nicht in Frankreich eingetroffen). Maar, in seinen Essays zu Proust, macht sich lustig darüber, wie der Ich-Erzähler in einem ihm völlig fremden Bordell und bei verdunkelten Gängen überhaupt diese Folterkammer gefunden hat – tatsächlich haben wir hier wieder ein frappantes (schlechtes Wortspiel, ich weiß) Beispiel vor uns, wie Proust seinen Ich-Erzähler immer wieder zu einem allwissenden Erzähler macht. Was Maar offenbar nicht gekitzelt hat, ist die hier wieder einmal durchbrechende voyeuristische Ader des Ich-Erzählers, die ihn jedes Mal irgendwelche homosexuellen Abenteuer Dritter entdecken lässt. Das Bordell, das ich in der Sekundärliteratur immer wieder als einen ganz üblen Ort geschildert finde, ist im Grunde genommen recht harmlos. Es ist ein von Jupien mit dem Geld des Barons gekauft und anders eingerichtetes ehemaliges Hotel. Die Verbrecher, die auf Charlus’ Geheiß angestellt werden sollten, um sein masochistisches Erlebnis echter zu machen, sind in Tat und Wahrheit einfache, harmlose Arbeiter aus der Gegend. Wenn sie versuchen, sich ihrer bösen Taten zu rühmen, kommen Dinge zum Vorschein wie jenes, dass einer ‚gesteht‘, einmal seinen Eltern beim Beischlaf zugeschaut zu haben. Der Ästhet Charlus spürt sehr wohl, dass diese ‚Verbrecher‘ keine sind – aber was soll er machen? (Und Jupien – das wird nicht gesagt, weil es wohl klar ist – würde sich hüten, echte Verbrecher zu engagieren, zu rasch würde deren Engagement wohl aus dem Ruder laufen.)
Banal gesagt, geht das Leben also in der ersten Hälfte des letzten Buchs der Suche nach der verlorenen Zeit trotz Krieg mehr oder weniger weiter wie bis anhin. Ein paar weitere Menschen aus dem Umfeld des Ich-Erzählers sterben, und er verzweifelt – endgültig, wie er meint – an seinen Qualitäten als Schriftsteller. Wiedergefunden hat er also noch nichts – im Gegenteil.