Zuerst sollten wir wohl den Titel erklären, den Michael Maar seiner Sammlung von Essays zu Marcel Proust gegeben hat. Er tut dies zum Glück selber am Ende seines ersten Essays, der den gleichen Titel trägt wie das ganze Buch: Proust Pharao:
Proust beschrieb es [sein Werk Auf der Suche nach der verlorenen Zeit] als ein Druidendenkmal auf dem Gipfel einer Insel, die nie jemand betreten werde. Aber es ist mehr als das. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit ist das Große Haus, nach dem der ägyptische König hieß und das dem legendären Leuchtturm von Pharos Taufe stand. Als phare säumt es noch heute die französische Küsten. Proust Pharao – leuchtend für alle, die durch den Nebel navigieren. Und wer von uns navigierte nicht durch ihn?
S. 13
Zusammen mit dem auf einer Art ums Buch gewickelten Bauchbinde zitierten Kritikers, der da wie folgt zitiert wird:
Maar ist nicht der erst, der Marcel Proust attestierte, Rettungsangebote für das Leben seiner Leser zu bieten, doch so originell und im besten Sinne kurzweilig hat das noch keiner getan.
Rolf-Bernhard Essig, Merkur
zusammen mit diesem Satz also ließ mich das zunächst so einiges befürchten. Ich habe nichts dagegen, dass man sich bei Problemen Rat von außen holt, aber dafür Bücher zu nehmen, erinnert doch sehr an die alten Stichorakel, bei denen mit einer Nadel in ein Buch (am besten in das Buch, die Bibel) gestochen wurde, und der Satz, den man so zufällig aufgespießt hatte, wurde so lange einer Exegese unterworfen, bis er einen Sinn und einen Ratschlag zur aktuellen Situation herzugeben schien. Oder wir denken an Philip K. Dick, der, wenn er in seinem aktuellen Buch nicht weiter wusste, die Hölzchen des I Ging warf und auf Basis von dessen Ratschlag weiter schrieb.
Ganz so schlimm war es dann nicht mit den hier versammelten Essays; von den sieben versuchen nur deren zwei Auf der Suche nach der verlorenen Zeit als eine Art Ratgeber für die Lesenden zu propagieren. Leider aber kranken die anderen – in der Reihenfolge ihres Auftretens heißen sie übrigens: Potiphars Frau, Wer starb als erster für Albertine?, Die Zofe der Madame Purbus, Céleste, Stechapfelträume und Tod sowie Spargel mit Fissuren – kranken sie also an einem anderen Gebrechen, das sie (jedenfalls für mich) mehr oder weniger ungenießbar macht: Sie versuchen, für Nebenfiguren des Romans die jeweiligen lebendigen Vorbilder festzumachen. Sicher basiert jeder Roman letzten Endes auf Erfahrungen seines Autors bzw. seiner Autorin, aber er erklärt sich nicht nur durch eine Rückführung auf solche tatsächlichen Erlebnisse und Personen. Bei der Suche nach der verlorenen Zeit kommt hinzu, dass sich Proust selber immer dagegen gewehrt hat, ihn als einen Schlüsselroman zu lesen. (Auch, nebenbei gesagt, widerspricht eine Behandlung als Schlüsselroman der anderen Behandlung als Ratgeberliteratur, die ja eben nicht spezifisch auf einen Fall, auf eine Person, gemünzt sein darf.) Eine nähere Präsentation von Céleste, Prousts Haushälterin, die einzige hier vorgestellte Person, von der Maar offenbar keine Spuren gefunden hat in Prousts Opus Magnum, mag zwar interessant sein, bringt aber natürlich fürs Verständnis von Auf der Suche nach der verlorenen Zeit wenig.
Letzten Endes liest man halt dann solche Aufsätze trotzdem pro domo, und so war für mich – selber Asthmatiker – der zweitletzte Essay (Stechapfelträume und Tod) der interessanteste, wo Maar beschreibt, wie Proust seine asthmatischen Erstickungsanfälle behandelt: nämlich, wie man heute weiß, so verkehrt wie nur irgend möglich: Daueraufenthalt in einem kalten und feuchten, wahrscheinlich auch moderigen Schlafzimmer, umgeben von Türmen von Kissen und Decken sowie jeder Menge Teppiche am Boden. Noch dazu räucherte er sein Schlafzimmer regelmäßig mit einem Mittel, das unter anderem Stechapfel beinhaltete. Wahrscheinlich konnte der Stechapfel die krampfhaften Zustände des Körpers ein wenig entspannen, gleichzeitig aber war es ein Mittel, das zur Sucht führte.
Dass ich diesen einen Essay mit Interesse gelesen habe, spricht zwar tatsächlich dafür, dass jede Lektüre in den Lesenden eine Beziehung herstellen können muss, eine Saite finden, die sie anschlagen kann. Das heißt aber immer noch nicht, dass jede Lektüre als Ratgeberliteratur dienen wird – ich für meinen Teil werde mich hüten, mein Schlafzimmer auszuräuchern oder mit Teppichen vollzustopfen.
Das Buch ist mit ein paar ganzseitigen Fotos von Marcel Proust illustriert. Sie sind (Proust verstarb 1922) natürlich für heutige Verhältnisse sehr unscharf, auf Grund des Rasterdrucks (man hat sie auf das normale Buchpapier gedruckt) noch unschärfer. Am Schluss des Buchs sind zwar Copyright-Vermerke angegeben (praktisch alle ullsteinbild), die aber keinerlei Rückschluss erlauben darauf, wann und wo die Fotos gemacht wurden. In Anbetracht dessen und der schlechten Reproduktionsqualität hätte man sie gerade so gut weglassen können.
Von den sieben Essays wurden die ersten beiden für diese Sammlung geschrieben; die anderen fünf erschienen bereits früher in Zeitungen und Zeitschriften, wurden aber noch einmal überarbeitet. Die Sammlung erschien in der vorliegenden Form erstmals 2009 im Berenberg Verlag, Berlin, und wurde dieses Jahr (2022) für die Büchergilde neu aufgelegt.
Fazit: Wer das Buch in einem öffentlichen Bücherschrank findet, mag es mitnehmen, lesen und wieder zurück tragen. Im Grunde genommen ist es aber, trotz Leineneinband und Fadenheftung, trotz Lizenzausgabe, zu teuer, wenn man nicht – wie leider ich – zu jenen paar Leuten gehört, die meinen, alles von und über Marcel Proust gelesen haben zu müssen.

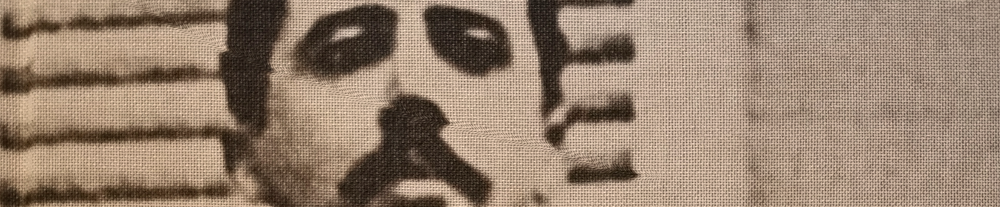
1 Reply to “Michael Maar: Proust Pharao”