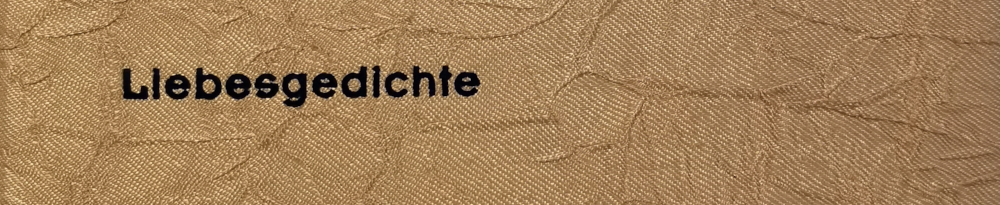Im Grunde genommen verwendet Dorothy Parker die gleiche Methode wie Jane Austen, wenn es darum geht, ihre Kritik zu formulieren am Patriarchat (um einmal dieses Schlagwort zu verwenden für den ganzen Komplex an sozialen, ökonomischen und gesellschaftlichen Benachteiligungen, denen Frauen bis heute ausgesetzt sind): Sie streut eine feine Schicht von Ironie über ihre Texte. Eine Ironie, die bei Parker wie bei Austen auch das eigene Geschlecht nicht ausnimmt – sind doch gerade Frauen oft die schlimmsten Patriarchen (was keine Entschuldigung für Männer sein soll!). Dadurch werden Austens Liebesromane ebenso wie Parkers Liebesgedichte zu mehr als eben nur einer simplen und kitschigen Angelegenheit. Nur wo Parker zusätzlich rassistische Verhältnisse anprangert, verlässt sie ihre Ironie. Das gilt für ihre Kurzgeschichten ebenso wie für ihre Lyrik. Farbige Frauen sind zusätzlich zu ihrer Unterdrückung durch das Patriarchat einer rassistischen durch (meist weiße) Männer und Frauen ausgeliefert und das ist für Parker Grund genug, diese Diskriminierung direkter anzugehen. Das ehrt ihr soziales Gewissen, spricht aber nicht für ihr künstlerisches. Denn es ist diese ihre Ironie, die ihre Erzählungen und ihre Gedichte davon abhält, in Kitsch abzugleiten.
Dabei ist ihr Werk, allen voran ihre Lyrik, auch von tiefer Melancholie geprägt. Tod und Sterben sind wichtige Motive ihres Dichtens. Auch Selbstmord zu begehen, überlegt sich das lyrische Ich mehr als einmal – nur um, in einem Fall, bei einer Aufzählung sämtlicher Methoden, Selbstmord zu begehen, gleich deren jeweilige Nachteile hinzuzufügen und zum Schluss zu kommen, dass es doch angenehmer ist, leben zu bleiben.
Auch wenn Parkers Gedichte formal streng gebaut waren und zum Teil alte Versmaße verwenden (was sie in den Augen der damaligen, auf die gerade modernen freien Verse fixierten Literaturkritik als altmodisch und epigonal erscheinen ließ): Ihre Botschaft ist klar und heute so aktuell wie damals. In all ihren Gedichten fordert die Autorin ein, dass Frauen nicht nur sozial und ökonomisch gleichberechtigt sind, sondern auch in Bezug auf ihre Sexualität. Sie fordert und schildert Frauen, die genauso promuisk leben wie viele Männer. Dass, was bei einem Mann als normale Sexualität gilt, bei Frauen dazu führt, dass sie pejorativ als ‚Luder‘ qualifiziert werden oder (fast ebenso pejorativ) als ‚Vamp‘, ist dann für sie das Thema, das sie in ihrer ironischen Art immer wieder variiert. Ihr lyrisches Ich kann sich verlieben und doch sexuelle Freiheit fordern oder monogam leben und doch nicht in ihren Partner / Ehemann verliebt sein. Es kann sich verlieben, ohne auf Sex erpicht zu sein, oder Sexualität einfordern, ohne verliebt zu sein. Diese Widersprüchlichkeiten sind wahrscheinlich der Autorin inhärent – man hat oft genug ihr lyrisches Ich mit der Person Dorothy Parker gleichgesetzt. Etwas, das Parker durchaus unterstützte, indem sie gegen außen dieselbe ‚Persona‘ kehrte, die auch ihr lyrisches Ich bestimmte.
Ob diese Gleichsetzung richtig ist, lässt sich nicht sagen. Aus heutiger Sicht ist es schwierig, festzustellen, wie viel von dieser ‚Persona‘ echt war und wie viel Spiel, denn private Papiere der Autorin sind nicht überliefert. Zumindest in der Literatur war sie nicht die erste, solch eine zwiespältige ‚Persona‘ mit ihren Widersprüchlichkeiten zu schildern. Spuren davon lassen sich in Shakespeares Personen erkennen. Das ironische Wiederzurücknehmen von etwas, das man gerade gegeben hat, findet sich auch bei Oscar Wilde. Last but not least ist die Zerrissenheit in Sachen Liebe durch Catulls „Odi et amo“ berühmt geworden – ein Satz, mit dem man problemlos jedes Liebesgedicht Parkers zusammenfassen könnte. Und ja: Sie kannte Shakespeare, Wilde wie Catull.
Sich als ‚femme fatale‘ zu präsentieren, so dass ihr lyrisches Ich mit ihrer ‚Persona‘ identifiziert werden konnte, war Parkers Taktik, um sozial und ökonomisch Erfolg zu haben in den 1920ern und 1930ern, die ihre ganz große Zeit waren, und aus der auch die hier versammelten Gedichte stammen. Wir finden den Inhalt all ihrer Gedichtbände: Genug Stricke von 1926, Gewehr bei Sonnenuntergang von 1928, Tod und Steuern von 1931, Nicht so tief wie ein Brunnen von 1936 und den Nachzügler Dorothy Parker fürs Handgepäck von 1944. Danach schrieb sie bis zu ihrem Tod 1967 keine Lyrik mehr.
Diese hier aber kann ich nur zur Lektüre empfehlen.
Vor mir liegt eine Ausgabe der Büchergilde Gutenberg. Es handelt sich um eine Lizenzausgabe der 2017 im Dörlemann Verlag in Zürich erschienen zweisprachigen Ausgabe, ins Deutsche übertragen von Ulrich Blumenbach, mit einem Nachwort von Maria Hummitsch, die letztes Jahr (2022) herausgekommen ist. Die Büchergilde hat dabei auf die englischen Originale verzichtet, weshalb ich darauf verzichte, die Qualität der Übertragung beurteilen zu wollen.