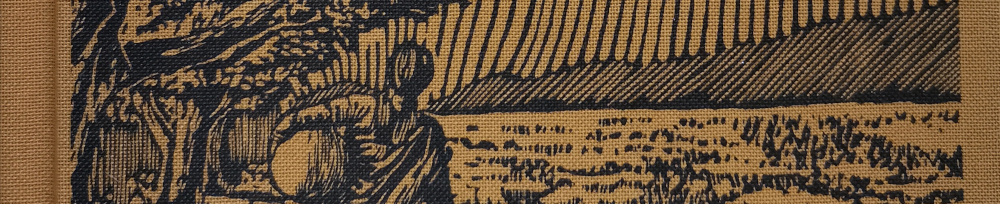1913 wurde Rabindranath Tagore für genau dieses Buch der Nobelpreis für Literatur verliehen. Er war damit der erste nicht-europäische Preisträger überhaupt, und auch der erste Lyriker. Wobei es hier nun kompliziert wird, und daran ist nicht zuletzt auch Tagore selber schuld. Denn mit „genau diesem Buch“ meine ich die vorliegende, von Tagore selber stammende Übertragung ins Englische einiger seiner Gedichte, damals (wie in meiner Ausgabe nun wieder) mit einem „Einführung“ genannten Vorwort von W. B. Yeats, in dem er Tagore aufs Höchste lobt. (Es gibt auch andere, weniger offizielle Aussagen von ihm, in denen er sich ganz deutlich und nicht ohne rassistische Untertöne darüber beklagt, dass – sinngemäß – „der Inder mit seinen seltsamen Gedichten den Buchmarkt für englische Lyriker wie ihn [Yeats] kaputt gemacht“ hätte.)
Nur weist meine Ausgabe (dieses Jahr – 2024 – bei der Folio Society in London erschienen) noch eine weitere Einführung auf, vom indischen Schriftsteller, Musiker und Professor für Literatur Amit Chauduri. Darin finden sich einige bemerkenswerte Hinweise, die ich so sonst nirgends gefunden habe, und über die ich kurz berichten werde.
Was wir nämlich vor uns haben, ist nicht Lyrik, sondern eine Prosa-Übertragung. Tagores Englisch ist sehr gehoben und archaisierend. Das macht aus den Gedichten eigentliche Prosa-Hymnen, eine Gehobenheit, die sie – so Chauduri – im originalen Bengali bedeutend weniger besitzen. Dort ist Tagore offenbar bedeutend fröhlicher und etwas mehr diesseits gewandt, als er im Englischen wirkt. Genau das, was Yeats so positiv heraushebt (und wohl auch der Nobelpreis-Jury so gefallen hat), ist also mehr eine Frage der Übertragung. Chauduri weist auf ein zusätzliches kleines Detail hin. Wenn es um „jenes höhere Wesen, das wir verehren“ (um hier auch Böll zitiert zu haben) geht, verwendet Tagore im Englischen Begriffe wie master (= Meister, Herr) und das Personalpronomen he ( = er). Diese Personalisierung, die uns im Westen natürlich sofort an einen dem christlichen Gott ähnlichen Weltenschöpfer und -erhalter denken lässt, gibt es so im Bengali nicht. Dort verwendet Tagore ein Pronomen, das Chauduri als gender-neutral shé beschreibt. Was im Englischen als mystische Gottesverehrung herüber kommt (und Yeats so fasziniert hat), war im Original eher eine mystische Verehrung der Natur, des Lebens, der Liebe, des Todes – die alle zusammen und keiner für sich allein jenem master entsprechen. Kein Monotheismus ist es also, was Tagore vertritt, eher ein dem Hinduismus entstammender, mystischer Pantheismus, wenn man so will – jedenfalls verstehe ich es als Logik-orientierter Mensch aus dem Westen so.
Ich habe bereits gesagt, dass die Texte auf Bengali weniger abgehoben klingen sollen, fröhlicher. Das hängt wohl auch damit zusammen, dass es nicht einfach Gedichte sind. (Fast?) alle sind nämlich ursprünglich – Lieder. Lieder, die Tagore selber vertont hat und die er selber gesungen hat. Dem Westen war das wohl nie wirklich klar, und ich kann mir vorstellen, wie Chauduri auf den Stockzähnen grinste, als sich 2016, 103 Jahre nach der Verleihung des Preises an Tagore, die halbe westliche Literaturwelt echauffierte darüber, dass mit Bob Dylan ein Singer-Songwriter den Nobelpreis für Literatur erhielt, verliehen, wie die deutsche Wikipedia aktuell schreibt (weit, weit unten versteckt), als erstem Singer-Songwriter und Dichter den Nobelpreis für Literatur „für seine poetischen Neuschöpfungen in der großen amerikanischen Songtradition“[…].
Last but not least: Wenn im deutschen Wikipedia-Artikel zu Tagore aktuell steht, [er] revolutionierte in einer als „Bengalische Renaissance“ bekannten Zeit die bengalische Literatur mit Werken wie Ghare baire (deutsch Das Heim und die Welt) oder Gitanjali […], so ist das auf Bengali 1910 erschienene Buch Gitanjali nicht identisch mit dem englischen Song of Offerings. Zum einen sind in der englischen Ausgabe bedeutend weniger Gedichte enthalten, zum anderen stammen einige Gedichte auch aus anderen Büchern oder sind sogar zum ersten Mal in dieser englischen Übertragung in einem Buch gesammelt, vorher nur in Zeitungen oder Zeitschriften erschienen.
So kommt es, dass 1913 ein indischer Autor den Nobelpreis für ein Buch erhielt, das in genau dieser Form in seiner Muttersprache gar nicht existierte. So kommt es, dass 1913 ein Singer-Songwriter den Nobelpreis für Literatur erhielt lange, bevor dieser Begriff überhaupt geprägt wurde. Und so kommt es, dass 1913 ein Lyriker den Nobelpreis für eine Sammlung von Gedichten erhielt, die dem Auswahlgremium nur in einer Prosaversion bekannt waren. Und da Tagore wohl nicht nur im deutschen Sprachraum praktisch vergessen ist, hat es auch mehr als ein Jahrhundert lang niemand bemerkt. Habent sua fata libelli …