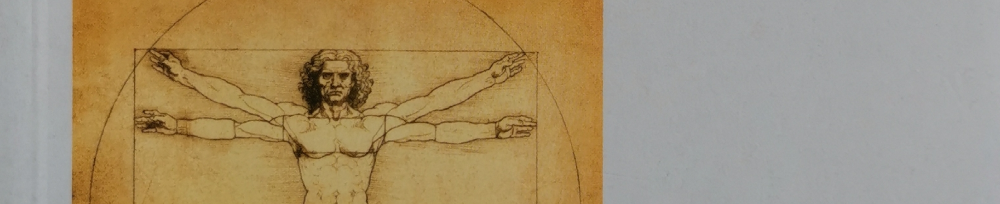Heute kennt man Arnold Gehlen, kennt man dieses Buch, eigentlich nur noch wegen der darin verwendeten Definition des Menschen als eines Mängelwesens. Ansonsten ist die Philosophiegeschichte über ihn ebenso hinweg gezogen wie über seine Mitstreiter in der so genannten Anthropologischen Philosophie, Helmut Plessner und Max Scheler. Gehlens Wiedererweckung in den 2010ern, auch und gerade im angelsächsischen Bereich, hat dieses Buch hier (und damit die Anthropologische Philosophie) nur am Rande betroffen.
Dabei könnte man es in verschiedener Hinsicht als ‚archetypisch‘ bezeichnen. Gehlen war vielleicht der erste (deutschsprachigen) Philosoph seit Kant, der versuchte, sein Philosophieren mit den aktuellen Erkenntnissen der Wissenschaft abzustimmen. Das betrifft in diesem Buch vor allem Fragen der Evolutionstheorie, der Sprachwissenschaft oder der Psychologie. Das Buch erschien zum ersten Mal 1940; die letzte von Gehlen noch bearbeitete Auflage erschien 1960. Die Entwicklung der Wissenschaften in diesen 20 Jahren hat Gehlen durchaus zur Kenntnis genommen und versucht, in den Neuauflagen zu integrieren. Das ist an und für sich lobenswert, führt aber zu zwei Problemen.
Zum einen fehlte Gehlen offenbar die Zeit oder der Überblick, um die Neuerungen an allen Stellen sauber einzuarbeiten. Das zeigt sich zum Beispiel an den neuesten Erkenntnissen der Paläoanthropologie bzw. deren Einfluss auf die Evolutionsbiologie. Wir finden Passagen, in denen Gehlen noch von der ursprünglichen Idee der Evolutionsbiologie ausgeht, nach der der Mensch evolutionärer Nachkomme der noch heute existierenden Menschenaffen war. An anderen Stellen aber nimmt Gehlen durchaus Kenntnis davon, dass die Erkenntnisse der Paläoanthropologie ganz klar darauf hinweisen, dass die Menschenaffen bestenfalls unsere Basen und Vettern sind, will sagen: eine Seitenlinie, deren gemeinsamer Vorfahre weit in der Vergangenheit liegt.
In diesem Beispiel ändert sich wenig an Gehlens grundlegender Argumentation für den Menschen als Mängelwesen. Aus Sicht des 21. Jahrhunderts macht sich aber etwas ganz anderes bemerkbar. Gehlen argumentiert, fraglos, damit, dass die Evolution quasi teleologisch arbeitet. Jede Weiterentwicklung ist eine Höherentwicklung und an der Spitze der Evolution steht, fraglos, – der Mensch. Gehlens Erkenntnis ist zwar nun, dass der Mensch, biologisch gesehen, gerade ‚primitiver‘ ist als seine Affen-Verwandten. (Er verwendet den Ausdruck ‚primitiv‘ per definitionem im Sinne von ‚weniger spezialisiert, weniger entwickelt‘.) Hände, Füße, Gebiss und andere Organe seien weniger spezialisiert als zum Beispiel bei den Menschenaffen – daher der Ausdruck des Mängelwesens. Heute, wo man nicht nur weiß, dass der Mensch nicht direkt vom Affen abstammt, sondern auch die Zielgerichtetheit der Evolution hin zu immer engerer Spezialisierung nicht mehr als wissenschaftlicher Standard gilt, läuft Gehlens Argumentation ins Leere.
Ein anderes Problem von Gehlens bewusster und immer wieder zur Schau gestellter Anlehnung an die Wissenschaft ist der Umstand, dass dies ihn dazu verführt, in extenso aus zeitgenössischen Schriften zu zitieren. Sofern man nun nicht gerade im Sinn hat, eine hoch spezialisierte Geschichte der Sprachwissenschaft an den deutschen Universitäten zwischen 1920 und 1960 zu schreiben, langweilen diese Forschungsergebnisse mehr als sie instruieren. Wo Gehlen sprachwissenschaftlich oder -philosophisch interessant ist, setzt er sich mit den Alten auseinander und den ganz Großen: Herder (der überhaupt sein eigentlicher Leitstern ist), Schiller, Wilhelm von Humboldt, Weisgerber oder Mead. Allerdings kommt Gehlen hier nicht weit. Er kritisiert zwar Herder für dessen Ansatz, den Ursprung der Sprache in der Nachahmung von Tierlauten zu sehen, kann aber selber dann keine andere Lösung liefern.
Ähnliches gilt bei der strikten philosophischen Argumentation Gehlens. Die Auseinandersetzung mit Plessner oder Scheler interessiert heute wohl kaum mehr – Sartre schon eher, den er gänzlich vor dessen eigentlich existenzialistischer Phase rezipiert. Wo er aber, zusätzlich zu den oben bereits Genannten, sich auseinandersetzt mit Kant (und da vor allem der Kritik der Urteilskraft), Novalis und – vor allem – Schelling (seinem zweiten Leitstern), weckt er das Interesse der Lesenden wieder – jedenfalls meines. Karl-Otto Apel hat Gehlen immer wieder erwähnt als Beispiel der frühen Rezeption des Pragmatismus in Deutschland. Das stimmt zwar. Gehlen erwähnt sogar Peirce ein oder zwei Mal, dem ist so. William James erscheint schon ein bisschen mehr, aber zur Hauptsache baut Gehlens (positive) Rezeption des Pragmatismus auf den Werken von John Dewey auf. Auch da müssen wir sagen, dass die Wiederaufnahme pragmatistischen Denkens in der deutschsprachigen Philosophie in den 1970ern und 1980ern Gehlen nur als eine Art Kuriosum zur Kenntnis nahm.
Ich habe den Text in einem Reprint der letzten Ausgabe von 1960 gelesen, und weiß nicht, wie weit ihn Gehlen in den Auflagen nach 1940 purgiert hat. Denn Gehlen mag, wie Karl-Siegbert Rehberg im Vorwort zu meiner Auflage festhält, kein in der Wolle gefärbter Nationalsozialist gewesen sein (Rehberg formuliert anders), aber er hat sich den Nazis doch ziemlich angebiedert (was auch Rehberg zugibt). Er war seit dem 1. Mai 1933 Mitglied der NSDAP, wurde 1934 Mitglied im NS-Dozentenbund. Zwar hütete er sich offenbar vor Verwendung allzu offensiver Nazi-Parolen, aber er profitierte persönlich ganz außerordentlich von seiner Parteitreue: Nach dem dieser entlassen wurde, übernahm er die Stellvertretung von Paul Tillichs Professur in Frankfurt/M, wurde Professor zunächst in Leipzig, später in Königsberg und schließlich, nach dem Zusammenschluss von Deutschland und Österreich, an der einstmals in gutem Ruf stehenden Universität Wien. Nach dem Krieg wurden die ‚großdeutschen‘ Professoren in Wien allesamt entlassen – allerdings keineswegs, um die von den Nationalsozialisten vertriebenen Leute wieder einzustellen. Schon 1947 konnte Gehlen in Deutschland seine Lehrtätigkeit wieder aufnehmen, wenn auch nicht mehr an den ganz großen Universitäten. Dennoch galt er in den 1960ern als eine Art konservativer Gegenspieler zu Theodor W. Adorno. Man vergaß schnell in Deutschland – auch, dass Adorno seinerseits 1933 ebenfalls bereit gewesen wäre, im Dritten Reich Karriere zu machen. Der Text (wie gesagt: zumindest in der Form von 1960) hält sich mit offensiven (rassistischen oder antisemitischen) Aussagen allerdings vornehm zurück.
Muss man Gehlen heute noch lesen? Meiner Meinung nach nicht. Kann man ihn noch lesen? Je nun … ja, doch.
Arnold Gehlen: Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt. Mit einer Einführung von Karl-Siegbert Rehberg. Wiebelsheim: AULA-Verlag, 2004.