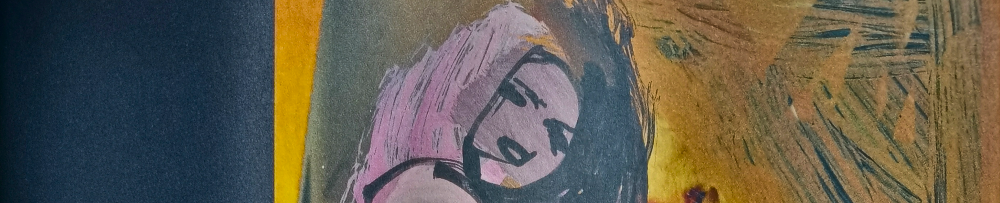Sacher-Masoch war auf dem Höhepunkt seiner schriftstellerischen Karriere kein ganz Unbekannter mehr. Seine Werke wurden gelesen und auch von anderen Schreibenden geschätzt, gerade in Frankreich, der Heimat des Naturalismus. Victor Hugo und Émile Zola hielten viel von ihm; Henrik Ibsen formte seine Frauen (auch) nach dem Vorbild der Frauengestalten Sacher-Masochs. Eine Reise Sacher-Masochs nach Paris im Jahr 1886 glich schon fast einem Triumphzug. Doch nur kurze Zeit später kam der österreichische Psychiater Krafft-Ebing auf den Gedanken, analog zum im Französischen bereits existierenden Begriff des ‚Sadismus‘ und basierend auf dem Inhalt der vorliegenden Novelle Sacher-Masochs, den ‚Masochismus‘ zu postulieren. Damit wollte er jene erotische Varianz definiert wissen, die sexuelle Lust und Erregung nur oder vorwiegend aus eigener Erniedrigung bzw. Erleiden von Schmerzen empfinden konnte. Er betrachtete den Masochismus als eine Entartung der normalen Sexualität, als pathologisches Phänomen, und verband ihn mit dem Sadismus. Ich weiß nicht, ob Krafft-Ebing selber auch von einer Perversion gesprochen hat. Die Psychiatrie brauchte lange, bis sie sich von dieser Betrachtungsweise gelöst hatte; erst seit den Arbeiten von Gilles Deleuze (der auch das Nachwort zu meiner Ausgabe verfasste und darin tatsächlich weniger aufs Buch eingeht als auf die Begriffs- und Medizingeschichte) änderte sich das großflächig. Sacher-Masoch half das nicht mehr. Sehr rasch wurden er und sein literarisches Werk nicht mehr als ‚slawisch-mystisch‘ betrachtet sondern als verworfen, krankhaft, pornografisch.
Aber das hier soll nicht ein Essay über den Masochismus werden sondern ein Aperçu über Die Venus im Pelz. Selbst mit dem in Bezug auf den sexuellen Kon- und Subtext des Werks vielleicht weniger voreingenommenen Blick des 21. Jahrhunderts würde ich nun nicht von ganz großer Literatur sprechen. Aber immerhin von einem Versuch, dahin zu gelangen.
Erzählt wird die Geschichte des galizischen Gutsbesitzers Severin von Kusiemski. Der war in seinen jungen Jahren offensichtlich ästhetisch-künstlerisch bemüht, zumindest rezeptiv. Er war auch ganz eindeutig ein bisschen überspannt – ästhetisch wie sexuell. So kommt es, dass er, als er einer jungen, verführerischen und reichen Witwe namens Wanda von Dunajew begegnet, diese Begegnung zugleich romantisch verkleidet (er sieht in seinen Wachträumen die Frau als Marmorstatue, die aber einen echten Pelz trägt) und damit seiner verdrängten Sexualität mit ganz eigenen Ideen Luft macht. Er rezipiert diese Frau wie ein künstlerisches Objekt und setzt sie gleichzeitig in ein Spannungsfeld von archaischer Religiosität (sie ist für ihn nicht nur Venus sondern auch Judith aus dem Alten Testament), dann aber auch in ein Spannungsfeld von Antike und Christentum. Diese Spannung kann er dann aber nicht ästhetisch auflösen, sondern überträgt sie in die Realität, auf das (Liebes-)Verhältnis zwischen Wanda und sich – aus der romantisierenden Statue wird die realistische Herrscherin über sein Leben. Eine Herrscherin im eigentlichen Sinn: Severin wird in jeder Hinsicht ihr Sklave, ihr Diener.
Seine Überspanntheit, die nicht wirklich zwischen Wunsch und Traum einerseits, der Realität auf der anderen Seite unterscheiden kann und will, führt schließlich dahin, dass er auf Wandas Nachfrage begeistert zustimmt. Die Frage war, ob er bereit wäre und sie immer noch lieben würde, wenn sie ihn zum Beispiel einem anderen Liebhaber zum Auspeitschen präsentieren würde. Severin ist ästhetisch-sexuell begeistert, in einer Art permanenten Ekstase. Doch die Realität holt sein Ideal ein und zerschmettert es. Als Wanda tatsächlich ausführt, was er im Vorfeld so begeistert akzeptiert hatte, platzt die ästhetische Blase, in der Severin gelebt hat. Tatsächlich finden wir ihn am Ende der Geschichte als stinknormalen Gutsbesitzer im Stil seiner Zeit – also als einen, der seine Frau beim kleinsten Fehler auszupeitschen droht und dieses Verhalten als einzig mögliches im Umgang mit Frauen ansieht.
In dieser Novelle steckt vieles drin – viel mehr als bloß der von Krafft-Ebing darin vorgefundene Masochismus. Das Spiel von Realität und Idealität, das uns Severin (wohl eher unwissend) darstellt, wird gespiegelt in der Rahmenerzählung. Die Geschichte von Severin und Wanda ist nämlich genau betrachtet die Binnenerzählung eines Rahmens, in der ein namenloser Freund Severins eines Nachts über einem Band mit Hegels Schriften(!) einschläft und seinerseits von so einer Venus träumt. Das romantische Doppelgänger-Motiv, das sich einer gutbürgerlichen dialektischen Aufhebung entzieht: Auch Hegel kann die Welt nicht beruhigen, nicht erklären.
Die weibliche Sexualität und Selbstbestimmung quillt in dämonisierter Form durch sämtliche Zeilen der Novelle. Auf Goethes Römische Elegien wird ein paar Mal angespielt – ein Hinweis darauf, dass die Zeit Sacher-Masochs sich dessen bewusst war, dass es der Goethe-Zeit noch möglich gewesen war, Ästhetik und Sexualität zusammen zu erleben, während nunmehr ein Zwiespalt empfunden wurde, den zu überbrücken nicht mehr möglich war. Es ist nicht von ungefähr, dass die Szene, in der Severin aus seinen Träumen erwacht, ausgerechnet in Florenz spielt – Florenz vielleicht die Stadt, in der ein Miteinander von antiker Schönheit und neuzeitlichem Genuss am ehesten verwirklicht scheinen konnte mit all den dort zu bestaunenden Kunstwerken aus Antike und Renaissance. Doch genau dort empfindet Severin die Unvereinbarkeit der Zeiten. Eine Renaissance, eine Wiedergeburt, ist selbst in ‚perverser‘ Form nicht mehr möglich.
Letzten Endes scheint dem ‚modernen‘ Menschen Sacher-Masochs nur der Regress auf / die Regression in Umgangsformen möglich, die weder antik noch christlich sind – sondern bei Licht betrachtet einfach nur brutal. (Den Begriff ‚tierisch‘, den ich beinahe verwendet hätte, sollte man auf solches Verhalten nicht anwenden. Kein Tier verletzt ohne Not eines der eigenen Spezies.)
Last but not least: Wandas Liebhaber, der schließlich Severin auspeitscht, ist Grieche. Das konnotiert sowohl die Antike mit wie auch eine andere ‚Perversion‘, die Homosexualität. Severin kann denn auch – trotz der Lage, in der er sich befindet – nicht anders als die schwellenden Muskeln des halbnackten Mannes zu bewundern. Mehr noch: Zu dem Wenigen, das wir aus der Vorgeschichte erfahren von Alexis Papadopoulis (wie der Grieche heißt), gehört, dass er schon als ganz junger Mann eine außerordentliche Schönheit war – so schön in der Tat, dass er sich auch schon mal als Frau kleidete und damit Erfolg bei den Männern hatte. Ein ganzes Meer unausgelebter, als bedrohlich erlebter Sexualität breitet sich vor uns aus. Und es zeigt sich, dass Severin nicht der kühne Seefahrer ist, für den er sich zunächst gehalten hatte.
Die Realität, könnte man Die Venus im Pelz zusammenfassen, ist bedeutend vielfältiger als die Imagination. (Eine Botschaft, die – in wahrhaft romantischer Manier – in einem Werk der Imagination übermittelt wird.)